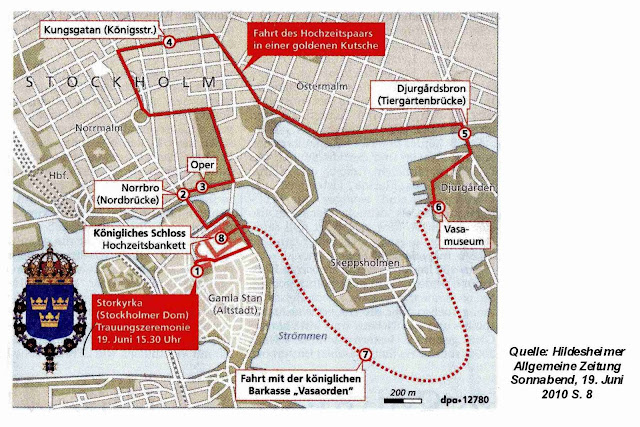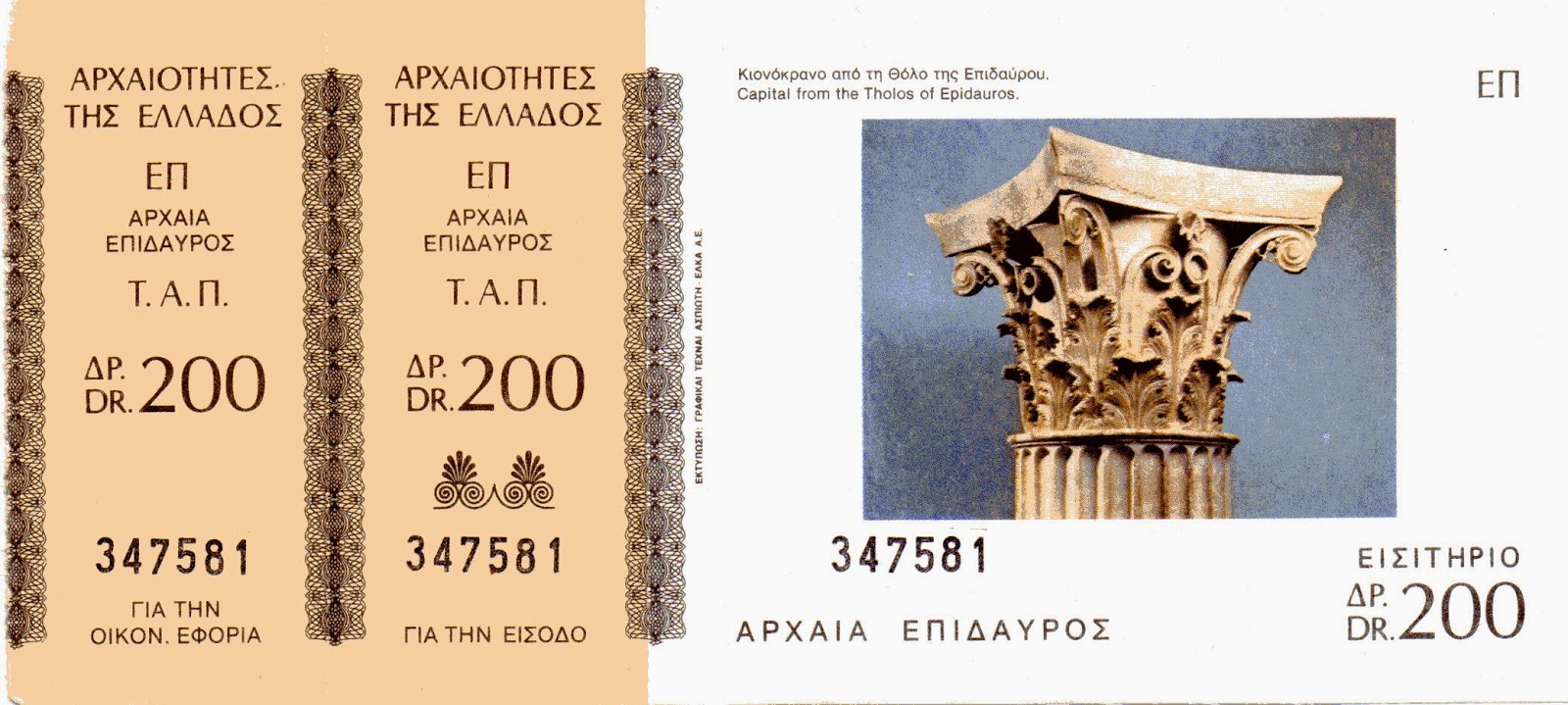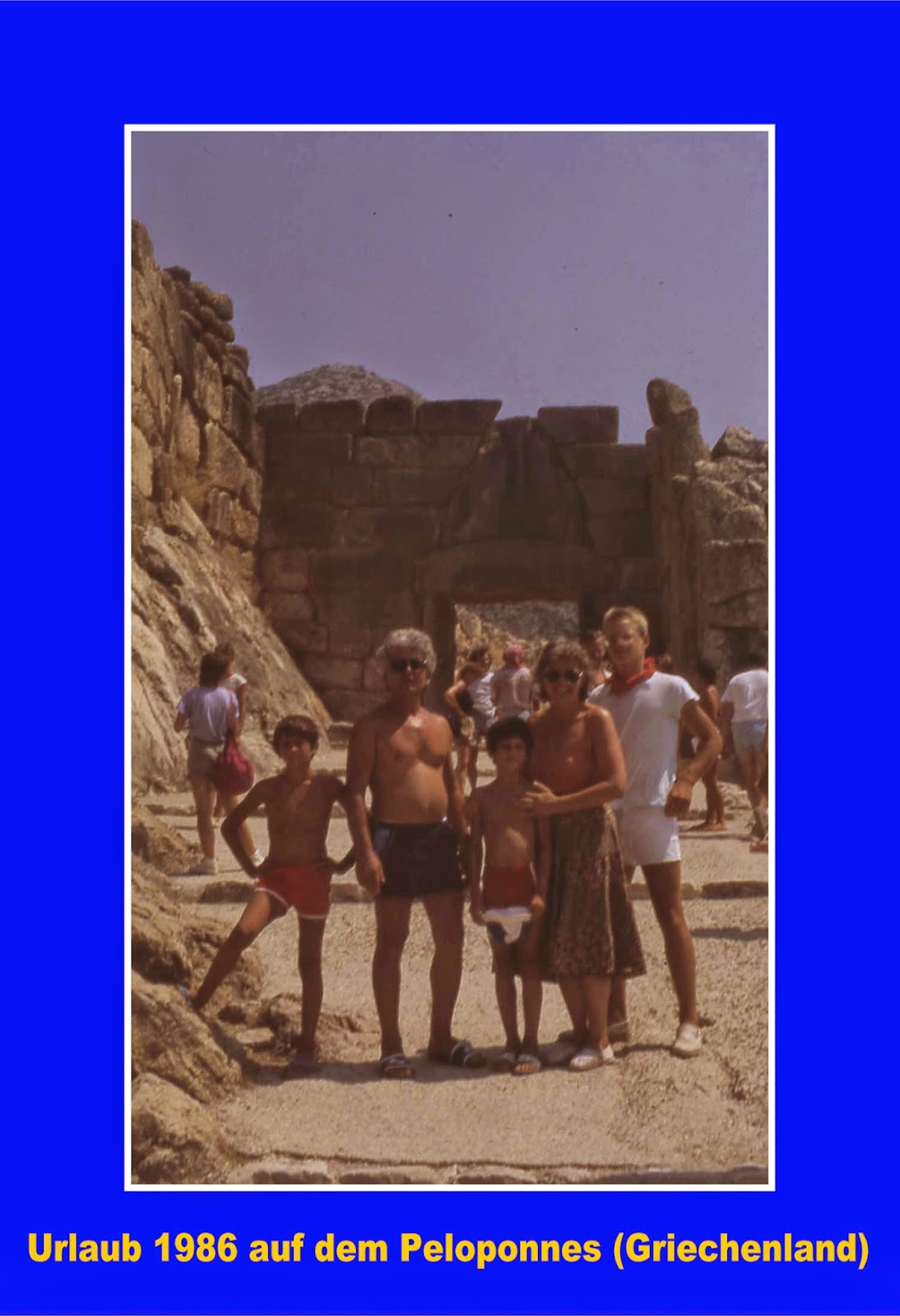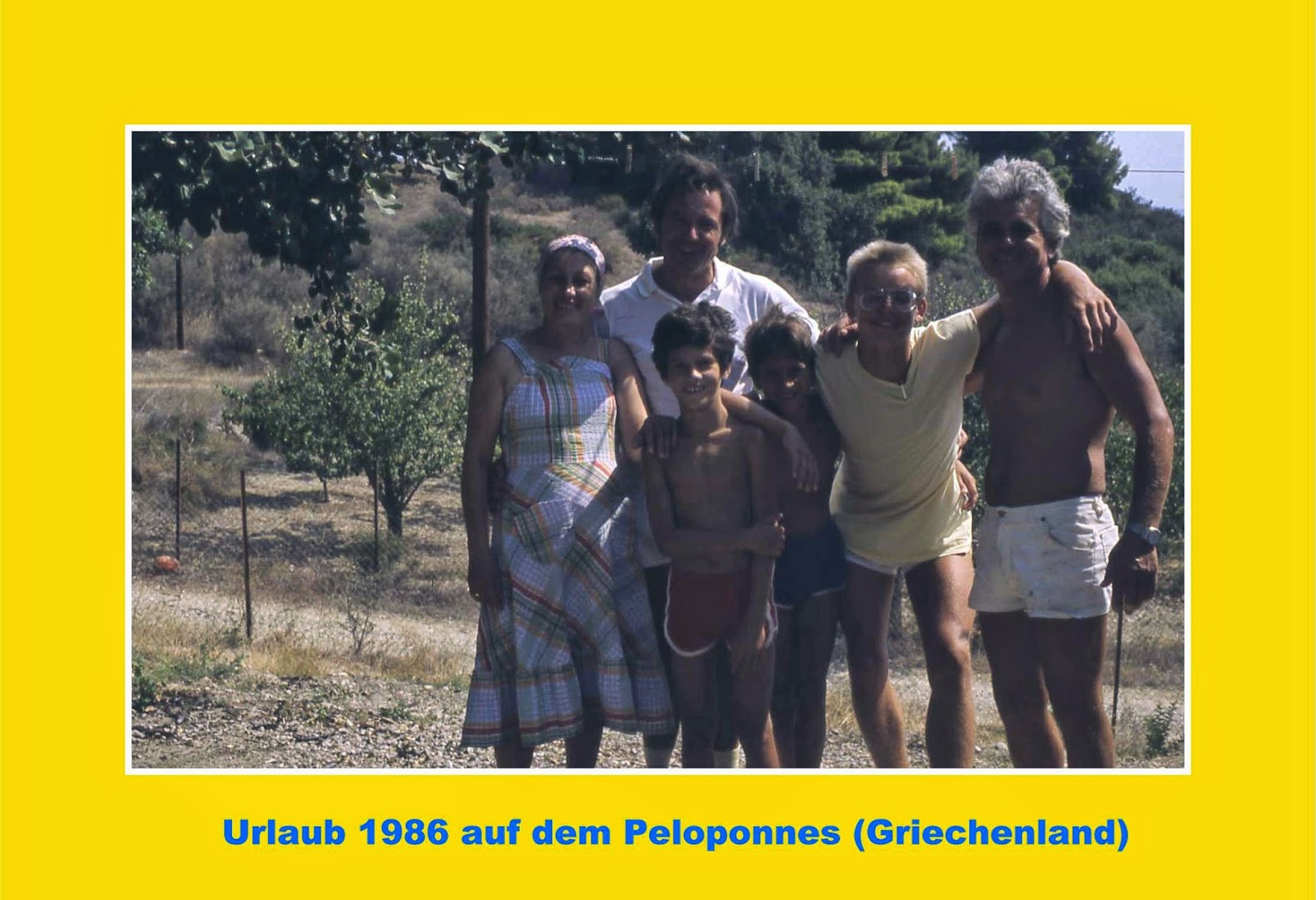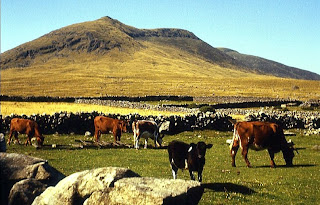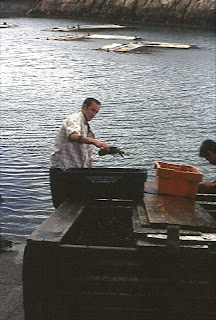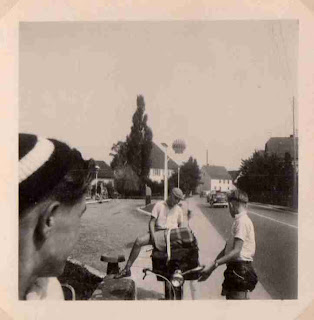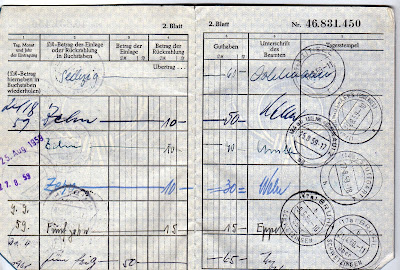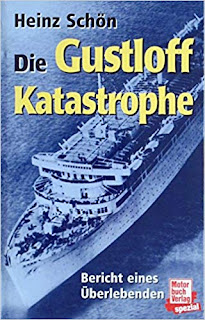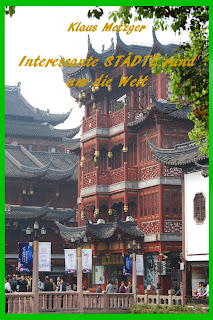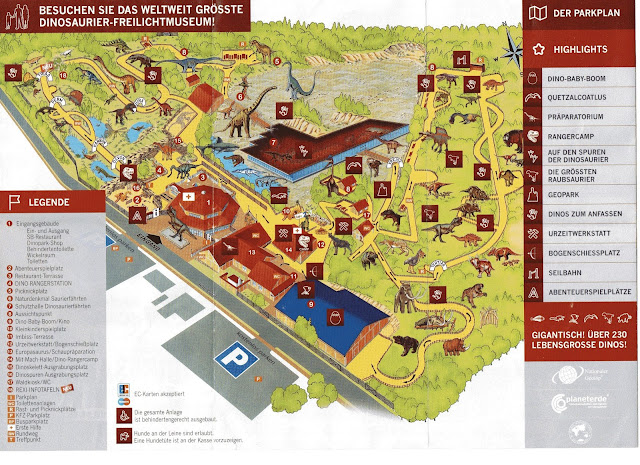Inhalt
- Cover
- 1. Einleitung
- 2. SKANDINAVIEN - von Kopenhagen zum Nordkap!
- 3. Über die AUTOPUT zum Windsurfen nach Griechenland
- 4. IRLAND - Wiedersehen nach 20 Jahren!
- 5. WEIMAR - eine Kulturstadt!
- 6. OSTSEE - Entspannung im MIRAMAR in Niendorf/Timmendorfer Strand!
- 7. Sommer 1959 - Radtour zum BODENSEE und 49 Jahre danach!
- 8. SWINEMÜNDE - eine Etappe unserer Flucht aus DANZIG!
- 9. FRANKREICH und das mittelalterliche COLMAR im Elsaß!
- 10. Das Selketal und die Burg Falkenstein im HARZ
- 11. Eine Kutschfahrt in der Lüneburger Heide
- 12. Mit dem Fahrrad entlang der WESER
- 13. Schlösser und Strände an der Dänischen Riviera
- 14. Kloster LOCCUM - auch eine Zisterzienser-Gründung
- 15. Erholung im Kloster HEGNE am Bodensee
- 16. Ein Ausflug nach GOTHA und ERFURT
- 17. Auf den Spuren berühmter Kurgäste in MARIENBAD (Tschechien)
- 18. MÜNSTER - zwischen Aasee und Dom
- 19. THALE und der Hexentanzplatz
- 20. Begegnung mit DINOSAURIERN in Münchehagen
- 21. Im Herbstmonat Oktober am Wörthersee
- Impressum

1. Einleitung
Vor einiger Zeit habe ich das interessante Buch "Unterwegs mit dem FLUGZEUG" von meinen zahlreichen Reisen zusammengestellt.

Vor mehr als 45 Jahren entstanden so eindrucksvolle Luftbilder von den Landschaften in Süd- und Mittelamerika.
Nach unseren zahlreichen Reisen mit dem Auto fand ich es deshalb sinnvoll, ein entsprechendes Buch mit dem Titel "Unterwegs mit dem AUTO" zusammenzustellen, das den größten Teil der spannenden Erlebnisse über größere und kleinere Entfernungen im In- und Ausland beschreibt.
2. SKANDINAVIEN - von Kopenhagen zum Nordkap!

| Wachwechsel in Kopenhagen |
Am 5. Januar 1977 reiste ich über die Vogelfluglinie Puttgarten - Roedby mit meinem AUDI 100 nach Kopenhagen, (Reisetipp "Kopenhagen") um bei unserer befreundeten Firma NIRO ATOMIZER A/S meinen Dienst als Kooperations-Ingenieur anzutreten (siehe auch meinen Reisebericht "Honduras"). Dieser Auslandsaufenthalt wurde von meiner eigenen Firma WIEGAND Karlsruhe GmbH finanziert und sollte drei Jahre dauern. Anfang Februar 1977 kam im Rahme des Umzuges von Karlsruhe nach Farum (bei Kopenhagen) auch meine erste Frau ULLA und mein Sohn Jochen (damals 6) nach. Bilder "Wachwechsel"
Da der Ausgangspunkt ca. 1.000 km nördlicher lag, war es naheliegend, in den Sommerferien die Abenteuer-Tour zum Nordkap zu wagen (die Gesamtstrecke verkürzte sich so von 7.300 auf 5.300 km). Und dann interessierte uns auch die berühmte Mitternachtssonne. Mein dänischer Kollege Joergen Hansen hatte diese Reise im Jahr vorher unternommen und gab mir nützliche Tipps. Vor allen Dingen wies er mich auf die zahlreichen Holzhütten hin, die es auf fast jedem Campingplatz in Skandinavien gab und die man auch für eine Nacht mieten konnte.
Am Montag, den 20. Juni 1977, starteten wir bei herrlichem Wetter von unserem Wohnort Farum (ca. 20 km nördlich von Kopenhagen), zu unserer spannenden Reise in Richtung Norden. Die erste Etappe nach Helsingör und mit der Fähre nach Helsingborg in Schweden kannten wir bereits von einem Ausflug Anfang April 1977. Damals war es noch sehr kalt und entsprechend winterlich gekleidet besuchten wir das "Hamlet-Schloss" Helsingör am Öresund. Uns imponierten auch die zahlreichen, älteren Kanonen, die immer noch in der Position waren, um die Einfahrt in den Öresund zu kontrollieren.
Nach einer Dauer von ca. 20 min kam die Fähre auf der gegenüberliegenden, schwedischen Seite in Helsingborg an. Bei dem Ausflug im April entdeckte meine Frau in den Geschäften von Helsingborg sehr schöne Glasarbeiten (Gläser, Kerzenhalter usw.). Daraus entwickelte sich später für mich die verantwortungsvolle Aufgabe, diese empfindlichen Waren im Rahmen unserer Besuche bei unseren alten Bekannten und Verwandten nach Süddeutschland zu transportieren. Für entsprechende Einkäufe war aber auf dieser Nordkap-Tour keine Zeit, denn als erste Reise-Etappe wollten wir Stockholm in ca. 600 km Entfernung erreichen. Dazu fuhren wir auf der E04 über Jönköpping über Norrköpping dem Tagesziel entgegen.
Seit dem 1. Juli 2000 gibt es eine weitere Möglichkeit, über den Öresund nach Schweden zu gelangen: die Öresundbrücke. Auf ihr fährt man in 10 Minuten von Kopenhagen in Dänemark nach Malmö in Schweden. Die 16 km lange Überquerung beginnt auf der dänischen Seite mit einem 4 km langen Unterwassertunnel, der direkt unter der Einflugschneise des Kopenhagener Flughafens liegt. Der Tunnelausgang liegt auf der künstlichen Insel Peberholm (Pfefferinsel - daneben liegt Saltholm, die Salzinsel). Dort beginnt die Auffahrt auf die 7.845 m lange Brücke mit einer Durchfahrtshöhe von 57 m. Über 2.000 Fahrzeuge rollen täglich über die Brücke, die 2 Milliarden Euro gekostet hat, und nun über Mauteinnahmen (28,30 € für die einfache Fahrt) refinanziert wird.
Dies war übrigens nicht der erste Kontakt mit Schweden: In der Zeit vom Sonntag, den 29. April, bis zum Dienstag, den 1. Mai 1973, begleitete ich meinen Vorgesetzten, Abteilungsleiter Brand, auf einem Repräsentationsbesuch zu unserer befreundeten Firma NIRO ATOMIZER A/S in Kopenhagen. Eine größere Gruppe neuseeländischer Kunden aus der Molkereiwirtschaft befanden sich auf einer Rundreise durch Europa und sollten im Rahmen von Betriebsbesichtigungen mit unseren neuesten Anlagen vertraut gemacht werden. Am Sonntagabend fand ein gemütliches Beisammensein in der entspannten Atmosphäre eines Kopenhagener Kro statt. Dort stellte mich Herr Brand dem Managing Director von NIRO ATOMIZER A/S, Mr. Harry Larsen, vor.
Damals konnte ich noch nicht ahnen, dass ich vier Jahre später als Mitarbeiter dieser dänischen Firma NIRO ATOMIZER A/S verantwortlich für einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren für den gesamten Eindampfanlagenbau im Konzern werden würde. Die Offenheit und Kontaktfreudigkeit meiner dänischen Kollegen lernte ich sehr schnell auf zahlreichen gemeinsamen Reisen zu schätzen. Und auf ihren Wunsch kam es auch zu der Entscheidung, mich Anfang 1977 als Koordinations-Ingenieur nach Kopenhagen zu berufen.
Am Montag, den 30. April 1973, fuhren wir mit dem Bus nach Helsingör und setzten mit der Fähre nach Helsingborg in Schweden über. Nach einer Fahrt von 30 km in östlicher Richtung erreichten wir die Molkerei AB Milkfood in Kaageröd. Dort war es meine Aufgabe, den interessierten Neuseeländern in englischer Sprache die Funktionsweise unserer WIEGAND-Eindampfanlagen im Betrieb zu erklären. Nach unserer Rückkehr konnte Herr Brand seine Freude über meine guten englischen Sprachkenntnisse gegenüber meinen Kollegen nicht verheimlichen.
Nach unserer Nordkap-Tour war ich wieder beruflich in Schweden. In der Zeit vom Mittwoch, den 28. September, bis zum Donnerstag, den 29. September 1977, begleitete ich meinen dänischen Kollegen, Dr. Pisecky, zu einem schwedischen Molkerei-Kunden in Vänersborg. Dr. Pisecky war ein renommierter tschechischer Wissenschaftler von der Universität in Prag, der 1968 beim Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts nach Dänemark geflüchtet ist. Er war bei NIRO ATOMIZER für wichtige Produktentwicklungen sehr erfolgreich verantwortlich. In Vänersborg konnte ich mich sehr gut mit meinen - noch - begrenzten dänischen Sprachkenntnissen unterhalten. Da ich mich darüber wunderte (Schwedisch ist - im Gegensatz zu der norwegischen Sprache - verschieden vom Dänischen) fragte ich nach der Erklärung und man antwortete mir: "Wir haben Skandinavisch gesprochen!".
Nun wieder zu unserer Nordkap-Tour: Wir kamen gegen 18 Uhr in Stockholm an. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, welchen Campingplatz mit Blockhütten wir ausgewählt haben. Ich kann mich nur noch erinnern, dass er außerhalb von Stockholm in nördlicher Richtung lag. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelte es sich um einen Campingplatz bei Sollenturna, denn dieser lag an der E04 (diese hatten wir bisher benutzt und auf dieser wollten wir in nördlicher Richtung weiterfahren). Am Dienstagvormittag, den 21. Juni 1977, fuhren mit unserem gepackten Wagen zurück ins Stadtzentrum von Stockholm. Bilder "Stockholm"
Dort interessierte uns besonders die "Gamla Stan" (die Altstadt) mit dem Kungliga Slott (Königliche Schloß), die Storkyrkan (Große Kirche) und die Tyska Kirkan (Deutsche Kiche). In diesem ältesten Teil von Stockholm ist der mittelalterliche Straßenverlauf noch erhalten und schattige, ruhige Plätze bilden Oasen der Erholung. Die "Gamla Stan" liegt auf einer Insel, die durch Brücken zu erreichen ist. Auf der Ostseite der "Gamla Stan" befindet sich der "Strömmen". Dort legen neben kleineren Fährschiffen auch Kreuzfahrtschiffe an. Früher ankerte hier der Dampfer Gripsholm - der Stolz der schwedischen Amerikalinie.
Bei der äußeren Besichtigung des königlichen Schlosses nahmen wir uns sehr viel Zeit (Jochen entdeckte auch ein interessantes, gußeisernes Pissoir der Jahrhundertwende) und hofften insgeheim, auch Königin Silvia zu sehen. Selbst in Kopenhagen war uns dies aber auch nicht mit Königin Margarete während unserer Zeit in Dänemark geglückt, obwohl sie für ihre Volkstümlichkeit bekannt ist und gerne alleine auf der "Ströget" einen Einkaufsbummel unternimmt. Später haben wir erfahren, dass in Schweden die königliche Familie im Schloß Drottningsholm (ca. 11 km entfernt in westlicher Richtung) lebt.
Es war schon ein besonderes Ereignis der damaligen Zeit als der schwedische Kronprinz Carl Gustav während der Olympischen Sommerspiele 1972 in München die bildhübsche, deutsche Chef-Hostess Silvia Sommerlath kennenlernte und sich in sie verliebte. Am 19. Juni 1976 fand die Trauung in der Storkyrkan und die anschließende Feier im Kungliga Slott auf der Gamla Stan statt. Da er als Kronprinz bei der Heirat mit der Bürgerlichen Sylvia Sommerlath auf die Thronansprüche hätte verzichten müssen, wurde er 1973 zum König Carl XVI. Gustav gekrönt.
Am 14. Juli 1977 (also kurz nach unserem Besuch am 21. Juni 1977 in Stockholm) kam Victoria Ingrid Alice Desiree als erstes Kind des schwedischen Königspaares auf die Welt. Aufgrund dieser Situation wurde 1980 auf Initiative des Parlamentes die Thronfolgeregelung geändert: Von nun an gilt in Schweden bei der Königsnachfolge das Erstgeburtsrecht, d.h. auch Frauen dürfen regieren. Somit ist also Victoria die schwedische Thronfolgerin. Sie hat sich am 24. Februar 2009 mit dem Bürgerlichen Daniel Westling (dem Teilhaber eines Stockholmer Fitness-Studios) verlobt. Nach alter Tradition wird die prachtvolle Hochzeit am 19. Juni 2010 (genau 34 Jahre nach der Hochzeit der Brauteltern) dieses jungen Paares wieder in der Storkyrkan und im Kungliga Slott stattfinden. Es sind über 1.000 Gäste aus allen Himmelsrichtungen geladen.
Die Hochzeit der Kronprinzessin Victoria mit Daniel Westling war eine sehr stimmungsvolle Veranstaltung. Meine Frau Jutta und ich sahen dieses Medienereignis im ZDF in der Zeit von 14 Uhr 30 bis 19 Uhr. Das glückliche Paar hatte großes Glück mit dem Wetter - wie wir auf dieser Skandinavien-Reise beim Besuch der schwedischen Hauptstadt. Fast auf den Tag genau (am 21. Juni 1977) vor mehr als 33 Jahren war ich mit meiner ersten Frau Ulla und meinem Sohn Jochen an all den Plätzen, wo jetzt die prunkvolle Hochzeit stattgefunden hat (siehe Schaubild). Nach dem Besuch der Storkyrkan (Trauungszeremonie) und des königlichen Schlosses (Hochzeitsbankett) und gingen wir teilweise den Weg der Hochzeitskutsche an der Uferstrasse entlang bis zum Vasa-Museum. Das Hochzeitspaar stieg dort in der königliche Barkasse "Vasaorden" mit den Ruderern um, die sie bis zum Schloss zurückbrachten. Wir benutzten ein kleines Fährboot fast auf derselben Route zum Strömmen (dort lagen jetzt die prunkvollen Yachten des dänischen und des norwegischen Königshauses vor Anker).
Es gibt noch eine andere Querverbindung, die mit dem ehemaligen Franzosen Jean Baptiste Bernadotte zusammenhängt. Dieser Marschall (er hatte diese Position als ehemaliger Sergeant unter Napoleon erreicht) der napoleonischen Armee wurde 1810 als Kronprinz nach Schweden geholt, da das damalige Königspaar kinderlos geblieben war. Er zog 1813 gegen Frankreich und Dänemark in den Krieg und in der Folge musste Dänemark sein Besitztum Norwegen abtreten. Norwegen wiederum mußte - gegen seinen Willen - eine Union mit Schweden eingehen, die bis 1905 Bestand hatte. 1818 bestieg Jean Baptiste Bernadotte als Karl XIV. Johann den Thron. Seine Nachkommen sind auch heute noch im Besitze des schwedischen Thrones. In Frankreich wird Bernadotte immer noch als Verräter betrachtet, da er gegen Napoleon gekämpft hat. Im Jahre 1928 ging die deutsche Insel MAINAU (am Bodensee) als Erbe in den Besitz des schwedischen Königshauses über. 1932 übernahm der 23-jährige schwedische Prinz Lennart Bernadotte die Verwaltung dieser Perle im Bodensee und machte sie für seine tropische Blütenpracht berühmt.
Da auch Prinz Lennart Bernadotte in erster Ehe mit einer Bürgerlichen verheiratet war, verzichtete er auf seine Thronansprüche. Im Alter von 95 Jahren starb er am 21. Dezember 2004. Während unserer Radtour zum Bodensee (vom 15. August bis zum 30. August 1959) kamen wir vom Wasserfall von Schaffhausen aus der Schweiz und besuchten bei Konstanz die wunderschöne Insel MAINAU, wo wir in der Nähe auch einen Campingplatz (Litzelstetten-Mainau) für unser 3-Mann-Zelt fanden. Da das Wasser an dieser Stelle sehr schlammig und trübe war, wählten wir als weiteres Domizil am Bodensee den kleinen Ort Ludwigshafen auf der gegenüberliegenden Seite. Unter dem Thema "Reisen meiner Jugend" werde ich auch diese Abenteuerreise (Startpunkt: Brühl bei Mannheim) mit zwei Freunden ausführlich behandeln.
Natürlich werden auf der Gamla Stan nicht nur prunkvolle Hochzeiten des schwedischen Königshaues gefeiert, sondern wir fanden im Gegenteil mehrere stille Plätze bei unserer Wanderung durch die Altstadt (auf einem DIA entdeckte ich eine Wanduhr mit der Uhrzeit - es war gegen 11 Uhr 30 am Dienstagmorgen als wir hier unterwegs waren). Am schmiedeeisernen Tor bei der Tyska Kyrkan fanden wir eine bezeichnende, deutsche Inschrift:
"Fürchtet Gott! Ehret den König!"
Diese spätgotische Kirche der deutschen Gemeinde wurde 1638 bis 1642 von dem Baumeister Hans Jakob Kristler gebaut, der aus Straßburg zugewandert war.
Auf unserem Spaziergang im alten Zentrum von Stockholm fiel uns auf der gegenüberliegenden Ost-Seite der Gamla Stan ein imponierendes Segelschiff auf, das ohne Besegelung vor der Insel Skeppsholmen vor Anker lag. Bei näherer Betrachtung erkannten wir bei unserem Rundgang den Namen: "af Chapman". Es dient heute als schwimmende Jugendherberge. Unterwegs kamen wir auch am beeindruckenden Grand Hotel vorbei. Dort wohnen in einem sehr festliche Rahmen die jährlichen Nobelpreisträger.
Da wir auch das Vasa-Museum besuchen wollten, ging unser Wanderweg weiter bis zur großen Insel Djurgaarden, an dessen westlichen Ende das interessante Schiffsmuseum liegt. Den Rückweg erleichterten wir uns, in dem wir ein kleines Fährboot zurück zum "Strömmen" auf der östlichen Seite der Gamla Stan benutzten. Welche Geschichte versteckt sich hinter der VASA? Eigentlich sollte das Schiff VASA der Stolz der schwedischen Kriegsmarine werden. Doch beim Stapellauf, am 10. August 1628, ging es nach weniger als 500 m mit Mann und Maus unter.
Der schwedische König Gustav II. Adolf gab den Auftrag für den Bau des größten Kriegsschiffes jener Zeit. Er befand sich damals im Krieg mit Polen und erfuhr von den Plänen seiner Gegner, ein ebenso mächtiges Schiff zu bauen. Deshalb liess Gustav II. Adolf mehr Kanonen als geplant an Bord schaffen. Das brachte jedoch die gesamte Statik des Schiffes durcheinander. Es lag so tief, dass bei entsprechendem Wellengang sehr leicht Wasser durch die unteren Geschützluken eindringen konnte. Zwei Windstöße genügten, um die Jungfernfahrt zur Katastrophe werden zu lassen, die über 30 Seeleuten das Leben kostete. Auch der Kapitän wurde verantwortlich gemacht, da die Geschützluken unvorschriftsmässig geöffnet waren.
Sofort nach dem Untergang versuchte man, die VASA zu heben. Doch nur die Kanonen konnten mit Hilfe einer Taucherglocke geborgen werden (eine technische Meisterleistung für die damalige Zeit). Normalerweise ist ein derartiges Wrack ein Fressen für den Schiffsbohrwurm. Doch das brackige Wasser der Ostsee mied der Schiffsbohrwurm und die VASA blieb unter Wasser intakt. Im Jahre 1953 begab sich der schwedische Ingenieur und Wrackforscher, Anders Franzen, auf die Suche nach der VASA und wurde drei Jahre später vor der Werftinsel Beckholmen fündig. Er benutzte dabei ein Lot, in dem beim Absenken Holzteile des Wracks hängenblieben. 1957 - also 333 Jahre nach dem Untergang - kam die VASA mit ihrer vollständigen Ausstattung wieder ans Tageslicht.
Wir besuchten die VASA in einem dämmrigen Raum mit einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit. Diese permanente Konservierung ist erforderlich, damit das Schiff nicht zerfällt. Über 20 Jahre später erzählte ich die Geschichte der VASA meiner zweiten Frau JUTTA, die als Tagesmutter arbeitet. Eines ihrer ersten Tageskinder war der pfiffige Dennis, der sich bereits im Alter von 3 Jahren für das Unglück der VASA interessierte. Sie erklärte ihm, dass der Kapitän damals zu viele Scheiben WASA-Knäckebrot auf das Schiff laden liess und es deshalb versank. Dennis war von dieser Katastrophe begeistert und Jutta erweiterte das Thema mit der Variante, dass man in Schweden Knäckebrot in entsprechenden Bergwerken gewinnt. JUTTA's Geschichten über meine Abenteuer in Südamerika sind bei ihren Kindern ebenfalls sehr beliebt und machen auch einen Teil ihres Erfolges aus.
Da wir erst gegen 14 Uhr von Stockholm in Richtung Norden weiterfuhren, schafften wir nur eine Entfernung von 240 km und kamen am Dienstagabend bis nach Söderhamn am Bottnischen Meerbusen. Wir fanden einen idyllisch gelegenen Campingplatz südostlich von Söderhamn. Lusnjefors Camping (bei Lusjne) lag direkt an der Ostsee und wir hatten dort mehrere Hütten zur Auswahl. Die Abendstimmung war einmalig, denn mit der untergehenden Sonne färbten sich die blonden Haare von Jutta und Jochen rostig-rot. In einer unwirklichen, aber interessanten Stimmung verabschiedete sich die Sonne im Westen. Bereits hier ließ sich der Einfluß der Mitternachtssonne erkennen, die zu dieser Jahreszeit weiter nördlich nicht untergeht.
Am Mittwochmorgen, den 22. Juni 1977, begeben wir uns auf eine weitere Etappe in Richtung Norden. Diesmal wollten wir Haparanda an der Grenze nach Finnland erreichen. Wir mußten dazu eine Entfernung von ca. 800 km zurücklegen. Der Tag begann mit einem Frühstücks-Picknick am Strassenrand, nachdem wir uns in einem Supermarkt in Söderhamn mit Proviant versorgt hatten. Söderhamn hat 30.000 Einwohner und erhielt im Jahre 1620 die Stadtrechte durch König Gustav II. Adolf (der auch die VASA bauen liess). Die Bedeutung der Stadt entstand durch die große Waffenschmiede (sie besteht heute nicht mehr), die das schwedische Kriegsheer mit Musketen versorgte.
Die Fahrt (auf der E04) entlang der Küste des Bottnischen Meerbusens vermittelte uns bereits einen Eindruck der Einsamkeit und der unberührten Natur. Das Wetter änderte sich. Der Sonnenschein, der uns bisher begleitet hat, verschwand von Zeit zu Zeit hinter Regenwolken und es wurde merklich kühler. Jochen versuchte sich als Angler und Steinewerfer, während meine Frau den Kaffee für die Pausen richtete. Wir fanden in dieser Umgebung sehr viel Ruhe und Gelassenheit, die sich auch auf uns übertrug und uns während der gesamten Nordkap-Tour nicht mehr verließ. Noch heute vermittelt sich mir der Eindruck, das wir von nun an immer alleine unterwegs waren - nicht einmal Touristen begegneten uns, die sich auf dem Rückweg befanden.
Ein ganz besonderer Campingplatz war Kukkolaforsen, der ca. 15 km nördlich von Haparanda lag. Neben zahlreichen Hütten gab es dort eine finnische Sauna ("Bastu" stand an diesem Blockhaus). Das kalte Wasser nach der Sauna fand man im nahegelegenen Grenzfluß Tornijonjaki. Obwohl ich damals ein regelmäßiger Saunagänger war, habe ich die Möglichkeit zum Saunieren leider nicht genutzt.
Haparanda wurde im Rahmen des Friedensbeschlusses von 1809 (Schweden verlor mit dem verbündeten England gegen Russland und Frankreich) gegründet, nachdem die östliche Nachbarstadt Tornio als Teil Finnlands (das damals als Provinz zu Schweden gehörte) an Russland abgetreten werden mußte. Damit ging die neue Grenze mitten durch das finnischsprachige Gebiet Schwedens mit dem Verlust der Handelsstadt Tornio. Deshalb wurde Haparanda aufgebaut, um diesen Verlust zu ersetzen.Über den großen Bahnhof von Haparanda wurden während des Ersten Weltkrieges Gefangene und Verwundete der Russen und der Mittelmächte (Deutschland, Österreich) ausgetauscht. Heute sind Haparanda und Tornio Schwesterstädte, die zwar durch den Grenzfluß Tornijonaki voneinander getrennt und trotzdem eng miteinander verbunden sind. Es ist kein großer Kulturunterschied zu bemerken.
|
|
Im finnischen Teil unserer Nordkap-Tour änderte sich nochmals die Landschaft, denn wir fuhren nun landeinwärts weiter in Richtung Norden. Wir entdeckten auf den Flüssen große Holzflosse, mit denen die vielen Baumstämme abtransportiert wurden. An diesem Donnerstagmorgen, den 23. Juni 1977, erreichten wir nach ca. 100 km das Verwaltungs-, Wirtschafts- und Kulturzentrum von Lappland, die Stadt Rovaniemi (Einwohnerzahl 35.000). Von hier sind es noch ca. 600 km bis zum Nordkap. Wir wollten auf dieser Tagesetappe aber nur bis Inari (in 350 km Entfernung) weiterfahren. Rovaniemi bestand früher wie auch die anderen Orte der nördlichen Region fast nur aus Holzhäusern. Im Rahmen der Kampfhandlungen zwischen deutschen und finnischen Truppen - während des "Lappland-Krieges" (Winter 1944/1945) - brannte die evakuierte Stadt zu mehr als vier Fünfteln ab. Noch Jahre danach beschimpften Finnen Deutsche als "Lapplandverbrenner". Nach Plänen des berühmten, finnischen Architektes Alvar Alto wurde Rovaniemi nach dem Kriege wieder aufgebaut.
In einer Entfernung von ca. 8 km nördlich von Rovaniemi kreuzt die Strasse Nr. E75 nach Inari den Polarkreis. Ab dieser Breite kann in den Monaten Juni und Juli die Mitternachtssonne beobachtet werden. Hier ist auch die Trennung der Polarzone von der nördlichen gemäßigten Klimazone. Am Tag der Sommersonnenwende, am 22. Juni (wir waren einen Tag später hier), erreicht der Weg der Sonne seine größte Neigung, so dass diese auch um Mitternacht in diesen Breitengraden am Himmel steht. Bezogen auf den Polarkreis ist dieses Phänomen des Polartages nur am 22. Juni zu beobachten (allerdings nur bei klarem Himmel). In Richtung Norden nimmt die Dauer zu. Uns gelang die eindrucksvolle Beobachtung der Mitternachtssonne in Norwegen (auf dem Campingplatz von Skibotn in der Nähe von Tromsö). Ich hatte meine Kamera mit dem Stativ aufgestellt und im Abstand von je einer Stunde die Mitternachtssonne aufgenommen. Leider wurde dieser DIA-Film aus mir unerfindlichen Gründen bei der Entwicklung beschädigt und die interessanten Bilder gingen verloren.
Mit dem Überschreiten des Polarkreises galten für das Fahren andere Bedingungen. Da nun größere Entfernungen ohne Tankstationen überbrückt werden mußten, war dies in der Logistik zu berücksichtigen. Auch mußte man von nun an mit Elchen und Rentieren rechnen, die urplötzlich den Weg kreuzen konnten. Von wichtiger Bedeutung war auch der einwandfreie Zustand meines Fahrzeuges, einem AUDI 100. Vor der Mückenplage in Lappland hatte man uns ausdrücklich gewarnt. Von haben aber davon garnichts verspürt. Vielleicht hing dies mit dem relativ kalten Wetter und dem bedeckten Himmel zusammen.
Bei meiner Firma KRUPP Chemieanlagenbau in Essen (1969 bis 1972) hatte ich in meinem älteren Kollegen, Dipl.-Ing. Regel, einen sehr hilfsbereiten und verständnisvollen Freund. Nach zwei älteren VW-Modellen (ich besitze den Führerschein Klasse 3 seit dem 12. Mai 1964) wollte ich Ende 1971 einen komfortableren Gebrauchtwagen kaufen, da wir mehrmals im Jahr mit unserem kleinen Sohn Jochen von Essen nach Brühl bei Mannheim fuhren, um unsere Eltern zu besuchen. Herr Regel kam überraschenderweise mit dem Vorschlag, einen Jahreswagen bei AUDI in Ingolstadt zu kaufen. Der Grund: er hatte dorthin Beziehungen, denn sein Schwager arbeitete damals im Vorstand bei AUDI.
Deshalb fuhr ich am 26.11.1971 mit dem Zug von Essen nach Ingolstadt, um mein neues Auto, ein roter AUDI 60, abzuholen (Kilometerstand: 37.962 km, Preis: 5.765,34 DM). Ohne größere Probleme legte ich mit diesem komfortableren Wagen bis zum Verkauf, am 27. November 1976 (Erlös 1.650,- DM), über 100.000 km zurück (darunter waren zahlreiche Urlaubsfahrten zum Sommerurlaub an die Cote d'Azur und zum Winterurlaub in die Dolomiten nach Italien). Da meine Versetzung nach Kopenhagen anstand, wollte ich Anfang Dezember 1976 ein neueres Auto kaufen und nahm deshalb wieder Kontakt mit AUDI in Ingolstadt auf.
|
|
Diesmal kaufte ich am 1. Dezember 1976 einen malachit-metallic-farbenen Jahreswagen AUDI 100 mit einem Kilometerstand von 20.029 km zum Preis von 12.370,95 DM. Mit diesem zuverlässigen und bequemen Wagen unternahm ich nun die Nordkap-Tour und wurde nicht enttäuscht. Probleme gab es erst im Januar 1978 als ich mein deutsches Nummernschild (KA-TS 126) gegen ein dänisches Kennzeichen (HK 46069) umtauschen mußte. Die dänische Finanzverwaltung wollte nun den Kaufpreis meines Wagens erneut als Steuer kassieren.
Ich einigte mich mit der Behörde auf eine Ratenzahlung von 10 Prozent pro Jahr, die mir von meiner Firma NIRO ATOMIZER A/S in Kopenhagen erstattet wurde (da ich Dänemark Mitte 1980 in Richtung Holland verlies, hatte ich 30 Prozent meines Wagenwertes zusätzlich als Luxussteuer bezahlt). Große Freude hatte mit meinem Auto ab September 1980 ein dänischer Nachbar, dem ich meinen AUDI 100 beim Kilometerstand von 107.000 km zum Preis von 25.000 Dkr. verkaufte. Als Technical Manager erhielt ich ab diesem Zeitpunkt bei NIRO ATOMIZER Holland einen neuen AUDI 100 als Dienstwagen.
Nach dem obligatorischen Foto am Polarkreis ging die Reise am Donnerstag, den 23. Juni 1977, in nördlicher Richtung weiter bis zur kleinen Siedlung Inari. Diese liegt am Inarisee, der der drittgrößte See Finnlands ist und mehr als eine doppelt so große Fläche wie der heimische Bodensee hat (den ich bereits 1959 auf unserer großen Radtour kennenlernte). Im See sind über 3.000 Inseln verteilt. Es ist eine sehr faszinierende Landschaft. Das Gebiet am Inarisee ist sehr dünn besiedelt - obwohl es mit 17.000 km² die flächengrößte Gemeinde Finnlands ist. In dem Ort Inari (an der Mündung des fischreichen Joenjoki in den Inarisee) leben nur 550 Menschen. Hier übernachteten wir erstmals auf unserer Reise in einem Sommerhotel (normalerweise eine Schule, die während der Sommerferien als Hotel verwendet wird).
Am Freitag, den 24. Juni 1977, wollten wir das eindrucksvolle Finnland wieder verlassen, um über die norwegische Grenze in das 330 km entfernte Hammerfest zu gelangen. Unterwegs begegneten wir erstmals zahlreichen Rentieren, die sich in der umliegenden, hügeligen Landschaft frei bewegten. In hölzernen Verkaufsständen unterwegs verkauften einfach gekleidete Samen (Lappen) Felle und Geweihe der Rentiere. Auf unserer Nordkap-Tour haben wir uns auch ein Rentierfell gekauft. Es machte uns aber keine große Freude, denn es begann sehr schnell zu haaren. Mein Freund und Arbeitskollege Ole ("der letzte Wikinger") verwendete das Fell später als dekorativen Wandschmuck in seinem Haus in Lyngby (bei Kopenhagen).
Kurz nach der finnischen Grenze gelangten wir in Norwegen nach ca. 20 km nach Karasjok. Dieser Ort (mit 2.800 Einwohnern) gilt als die heimliche Hauptstadt der Samen und liegt an der E6, deren östlicher Endpunkt die Hafenstadt Kirkenes an der russischen Grenze ist. Bis dorthin gelangen auch die Postschiffe der Hurtigroute. Auf der E6 in nordwestlicher Richtung ging es dann weiter nach Lakselv (in ca. 74 km Entfernung). Unterwegs legten wir einen Stopp ein. Am Strassenrand fotographierte ich ein Hinweisschild: 40 km bis Lakselv. Nach Lakselv fuhren wir auf der E6 an dem großen Fjord Porsangen entlang in nördlicher Richtung. Nun befanden wir uns wieder an der Küste und gewannen interessante Eindrücke: z.B. eine kleine Insel, die sich parallel zur Küste erstreckte, sah aus wie der Rücken eines Walfisches. Nach ca. 50 km änderte die E4 bei Kistrand wieder die Richtung und es ging landeinwärts in westlicher Richtung bis zu unserem Tagesziel "Hammerfest".
Der erste Eindruck von Hammerfest war imponierend, denn wir kamen über eine Berghöhe (der Höhenzug Salen) und die Bucht mit dem Hafen und den Häusern lag eindrucksvoll unter uns. Viel weniger imponierend waren die Holzhütten, die auf einem Geröllfeld standen (sogar Rentiere kamen hier vorbei). Ich weiß heute nicht mehr, warum wir uns für eine Holzhütte zur Übernachtung in Hammerfest entschieden haben. Vielleicht waren alle Quartiere belegt? Auf jeden Fall war die Hütte ein großer Reinfall, denn wir haben in der Nacht ganz schlimm gefroren. Sogar die Herdplatten, die ich als Heizquelle eingeschaltet hatte, brachten keine Erwärmung. Der Rest aus der Cognac-Flasche, die ich aus einem Duty Free Shop von meiner England-Reise vor unserer Nordkap-Tour mitgebracht hatte, half mir etwas bei meiner inneren Erwärmung - was meiner Frau aber garnicht gefiel und mir entsprechende Vorwürfe einbrachte. Wenn unser Sohn nach unserer Rückkehr über die Nordkap-Reise befragt wurde, denn antwortete er immer wie aus der Pistole geschossen:
"In HAMMERFEST, da haben wir fest gefroren!"
Hammerfest (9.000 Einwohner) hat einen eisfreien und geschützten Hafen und liegt auf der Westseite der 339 km² großen Insel Kvaloey. Im Jahre 1789 erhielt Hammerfest das Stadtrecht. Leider ist sie nicht mehr die nördlichste Stadt der Welt, da Honningsvaag beim Nordkap vor kurzem ebenfalls Stadtrechte bekommen hat. Hammerfest ist Ausgangspunkt für die Fischerei im nördlichen Eismeer und mit der Fischfabrik FINDUS befindet sich ein wichtiger Arbeitgeber im Hafengelände. Als wir den Hafen besichtigten, war gerade das norwegische Fernsehen anwesend, um eine junge Musikgruppe in ihren prächtigen, roten Uniformen zu filmen.
Wegen der langen Polarnacht, die vom 21. November bis zum 23. Januar dauert, ist verständlich, dass in Hammerfest als erster Stadt Europas vor mehr als 100 Jahren eine elektrische Strassenbeleuchtung installiert wurde. Die Mitternachtssonne dauert vom 17. Mai bis zum 28. Juli. Auch hier haben die deutschen Truppen (in Finnland nannte man sie "Lapplandverbrenner") ihre zerstörerischen Spuren hinterlassen: nach der Zwangsevakuierung 1944 wurde die Stadt von den Deutschen dem Erdboden gleichgemacht. Unterhalb des Höhenzuges Salen und am Meer wurden die Häuser nach dem Kriege wieder aufgebaut. Seit Jahren profitiert Hammerfest vom norwegischen Ölboom. Die Postschiff der Hurtigroute laufen Hammerfest täglich an. Normalerweise kann man mit Schnellbooten in 6 Stunden nach Honningsvaeg auf der Insel Mageroeya gelangen, um von dort mit dem Bus oder Taxi das Nordkap zu erreichen. Leider war es Ende Juni noch viel zu kalt und der Weg zum Nordkap war eingeschneit. Deshalb war auch die Schnellboot-Verbindung zu unserer Zeit eingestellt.
|
|
Bei einem ausgezeichneten Abendessen (es gab u.a. "Graved Laks") versöhnten wir uns mit dem Gedanken, auf dieser Tour aus Wettergründen nicht das Nordkap erreichen zu können. Und am kommenden Samstagmorgen, den 25. Juni 1977, schlug der unangenehme Wettergott wieder zu: es regnete in Strömen als ich unser Auto mit dem Gepäck belud.
Andrerseits fiel es uns nun auch leicht, uns wieder in südlichere Gefilde zu begeben. Als Tagesziel wollten wir am 6. Tag den Campingplatz in Skibotn in 430 km Entfernung erreichen. Deswegen fuhren wir zurück nach Skaidi, wo wir wieder auf die E6 trafen (die wir hier auf dem Weg nach Hammerfest verlassen hatten).
Nun durchquerten wir in südwestlicher Richtung eine Hochebene, auf der sich "Hund und Katz Gutenacht sagten" (das Sennalandet mit Erhebungen von 662 bzw. 671 Meter). Dort fanden wir wieder Verkaufsstände der Samen, die sich aber offensichtlich besser auf die Touristen der Nordkap-Tour eingestellt hatten. Sie trugen ihre landestypische Tracht und das Angebot war sehr viel umfangreicher als wir es in Finnland kennengelernt hatten. Bei Rafsbotn kamen wir auf einer kurvenreichen Strecke herunter zum Altafjorden, an dessen südlichen Bucht die Stadt Alta liegt.
In dieser Bucht sah ich erstmals den berühmten Stockfisch, der auf einem großen Gestell zum Trocken aufgehängt war. Um den Trockenfisch vor Möven zu schützen, waren über den Fischen Netze gespannt. Fast 20 Jahre später entdeckte kleinere Gestelle mit Stockfischen auf der Insel LANZAROTE. Auf einer spannenden Radtour mit einem geliehenen Mountainbike kam ich über die Gebirgskette bei Haria zum Fischereihafen Orzola, wo ich den Stockfisch fand (siehe Reisebericht "Lanzarote").
Alta hat 17.000 Einwohner und ist die größte Stadt des Verwaltungsbezirkes Finnmark (zu dem auch Lakselv und Kirkenes gehören). Sie liegt an der E6 und dort mündet der Alta-Fluß (der bekannteste Lachsfluß Norwegens) in den Altafjord. In Alta ist die Mitternachtssonne vom 16. Mai bis zum 26. Juli zu sehen und die Polarwinter dauert vom 24. November bis zum 1. Januar. Fährt man von Alta in westlicher Richtung an der Küste entlang, so gelangt man nach Kaafjord. Dort hielt sich während des Zweiten Weltkrieges das deutsche Schlachtschiff "Tirpitz" versteckt, bis es 1943 von britischen Mini-U-Booten versenkt wurde.
Wir nutzten die schöne Aussicht am Altafjord zu einer Kaffeepause und ein kurzer Blick auf unseren eleganten AUDI 100 zeigte uns, welche unbefestigten Strassen wir auf dem Weg von Hammerfest nach Alta bewältigt hatten. Der Dreck an der Karosserie wäre heutzutage die richtige Dekoration für einen Geländewagen mit Vierradantrieb (damals gab es derartige Fahrzeuge für private Nutzer noch garnicht). Danach freuten wir uns schon auf unsere Holzhütte auf dem Campingplatz von Skibotn, denn das Wetter war besser geworden und der Regen hatte nachgelassen. Bei Skibotn mündete die E8, die von Finnland kommt, in die E6, auf der wir seit einiger Zeit unterwegs waren. Abseits von der üblichen Nordkap-Route in Norwegen ging es dann auf der E8 weiter nach Tromsö.
Obwohl es etwas wärmer wurde, konnte man den Einfluß des Winters immer noch an den umliegenden Bergen erkennen, denn diese waren immer noch schneebedeckt - genauso wie wir es auf der Fahrt von Hammerfest immerwieder erlebt hatten. Die Sonne stand den ganzen Tag am Himmel und dies war für mich auch der Anstoß, die Mitternachtssonne zu fotographieren. Wie ich bereits berichtet habe, ging diese Aktion aber vollständig daneben. Vielleicht ist mir das Schicksal gnädig und gibt mir nochmal in diesem Leben eine Chance (offene Lizenzforderungen!), den Lauf der Mitternachtssonne festzuhalten. Mit meiner zweiten Frau Jutta (sie ist 12 Jahre jünger als ich) habe ich schon unglaubliche Abenteuer erlebt (siehe z.B. den Reisebericht "Irland" ) und mit ihr würde ich gerne diese Nordkap-Reise wiederholen. Sie könnte sich aber auch eine gemütliche Tour mit dem Postschiff auf der Hurtigroute vorstellen.
|
|
|
|
|
|
Am Sonntag, den 26. Juni 1977, hatten wir uns eine kurze Etappe (auf der E8) vorgenommen, denn wir wollten in ca. 120 km Entfernung die interessante Stadt Tromsö besuchen und dort übernachten. Und wieder (wie in Inari/Finnland) haben wir uns für ein bequemes Sommerhotel entschieden. Es ist immer noch bemerkenswert, wie mein Sohn Jochen mit seinen 6 Jahren (geboren am 12. Februar 1971 in Essen-Werden) diese strapaziöse Reise ohne größere Probleme gemeistert hat. Typisch ist ein Bild von damals (vor Tromsö aufgenommen), das ihn beim entspannten Spielen auf einer Wiese zeigt. Diese halbe Stunde brauchte er täglich.
Die Hafenstadt Tromsö hat 58.000 Einwohner und liegt auf einer kleinen Insel, die mit dem Festland durch die Tromsö-Brücke (mit einer Durchfahrtshöhe von 43 m) verbunden ist. Eine besondere Attraktivität ist die Eismeer-Kathedrale (1965 von Jan Inge Hovig gebaut), die wir besucht und im Inneren fotographiert haben. Sie symbolisiert mit ihren beindruckenden Glasmalereien die dunkle Polarnacht und das Nordlicht. Der Ort entstand im 13. Jahrhundert und erhielt 1794 das Stadtrecht. Viele Polar-Expeditionen starteten vom Tromsö-Hafen - deshalb der Name "Tor zur Arktis". Zahlreiche bekannte Forscher, wie die Norweger Fridtjof Nansen und Roald Amundsen, begannen hier mit ihren Forschungsreisen. Von Roald Amundsen entdeckte ich in Tromsö ein Denkmal, auf dessen Kopf sich sinnigerweise gerade eine Taube niedergelassen hatte. Die Postschiffe der Hurtigroute legen hier täglich an. Im Sommer kann die Temperatur bis auf 25 grd. C ansteigen. Deshalb fielen uns in den Vorgärten auch die zahlreichen Blütenpflanzen auf. Interessant war das Kabellegerschiff, das im Hafen vor Anker lag.
|
|
Auf unserem Weg in Richtung Süden verliessen wir am 8. Tag (am Montagmorgen, den 27. Juni 1977) die E8 bei Nordkjosbotn und fuhren auf der E6 weiter. Eines der wenigen Fotos des Fahrers entstand während der Kaffeepause in der Nähe von Moen. Nun wurde die gesamte Landschaft sehr viel eindrucksvoller und zeigte auch einen Hauch von Frühlingserwachen. Hier sahen wir erstmals die berühmten norwegischen Fjorde und besonders malerisch lag die Hafenstadt Narvik am Ofotfjorden. Dies ist auch eine beliebte Anlegestelle für die Spitzbergen-Kreuzfahrten im Sommer. Als wir an Narvik vorbeifuhren, konnten wir im Hafen ein Kreuzfahrtschiff erkennen.
Die Hafenstadt Narvik hat 18.500 Einwohner und liegt am westlichen Ende einer Halbinsel. Durch den Ofotfjord ist diese mit dem Atlantik verbunden. Im Jahre 1902 erhielt Narvik die Stadtrechte. Am eisfreien Hafen endet die Ofotbahn (schwedisch Lapplandbahn), die Erz vom schwedischen Kiruna anliefert. Im Zweiten Weltkrieg besetzten die deutschen Truppen Norwegen, um in Narvik die Zufuhr schwedischer Erze zu sichern. Es gab erbitterte Kämpfe mit den Engländern und die Stadt Narvik wurde sehr stark zerstört. In den 50er-Jahren ersetzte man die alten Holzhäuser durch einfache Steinbauten.
Die Reise ging weiter auf der E6 bis zum Campingplatz Bognes, der ca. 90 km von Narvik entfernt lag. Kurz vor dem Ziel durften wir unsere erste Fähre auf der Nordkap-Tour benutzen, die uns in 25 min über den Tysfjorden brachte. Diese verkehrt in der Zeit vom 12. Juni bis zum 23. August stündlich. Auf der folgenden Etappe (9. Tag nach Mosjoen) benutzten wir unsere zweite Fähre von Sommarset nach Bonnaasjoen über den Lejrfjord. Seit 1986 gibt es diese Fährverbindung nicht mehr, denn nun existiert eine 31 km lange Strasse mit 6 Tunneln.
In Bognes fanden wir eine sehr schöne Holzhütte, die direkt am felsigen Strand des Tysfjorden lag. In Erinnerung habe ich immer noch das nervöse Gezwitscher der Strandläufer, die in der Nähe auf und ab spazierten. Jochen ließ sich von den Vögeln nicht stören und übte sich wieder einmal als Steinewerfer. Am folgenden 9. Tag (Dienstag, den 28. Juni 1977) lag eine Strecke von 420 km vor uns, bis wir den Campingplatz von Mosjoen erreichten. Wir gelangten wieder in höhere Bereiche und konnten von hier die immer noch schneebedeckte Landschaft erkennen (dies ist einer der bleibenden Eindrücke: Frühlingsstimmung und Winterimpressionen wechselten sich auf unserer Nordkap-Tour immerwieder ab). Bei Fauske entdeckten wir die Eisenbahnlinie der Nordlandbahn, die von Trondheim kommt und 1962 bis zur Endstation Bodö fortgeführt wurde.
Ein besonderer Moment war auf dieser Etappe die erneute Überquerung des Polarkreises (dieses Mal in südlicher Richtung). Am 4. Tag hatten wir in Finnland bei Rovaniemi den Polarkreis in nördlicher Richtung passiert. Bei den jeweiligen Wetterverhältnissen ergaben sich beträchtliche Unterschiede. In Finnland blühten die Blumen (dort lag die Passage auf Meereshöhe) und in Norwegen (bei Stödi) gab es Berggipfel (der Bolma in westlicher Richtung) mit 1.506 Meter Höhe und das Klima war entsprechend rauh. Der Campingplatz von Mosjoen und die schöne Holzhütte übertraf unsere Vorstellungen, denn hier herrschten nahezu Sommerbedingungen. Jochen beobachtete voller Begeisterung junge Camper, die gemeinsam ihr Hauszelt aufbauten. Gerne wären wir noch einen Tag länger geblieben (es hatte erstmals den ganzen Tag die Sonne geschienen) - aber andrerseits zog es uns auch weiter in Richtung Süden - der Heimat entgegen.
Am darauffolgenden Mittwoch, den 29. Juni 1977, wollten wir auf jeden Fall die größere Stadt Trondheim erreichen. Dazu mußten wir eine Strecke von ca. 400 km zurücklegen. Auf einem Rastplatz in der Nähe von Steinkjer kam es durch eine Unachtsamkeit zu meinem ersten Unfallschaden an meinem AUDI 100. Beim Zurückfahren hatte ich wohl vergessen, dass sich hinter mir ein Hinweisschild befand, das an einem senkrechten Rohr befestigt war. So handelte ich mir eine kleine Beule am Kofferraumdeckel und an der Stoßstange ein. Ich war erst etwas ärgerlich, dass meine Mitfahrer beim Rückwärtsfahren nicht mit aufgepasst hatten. Die Beule an der Stoßstange habe ich vor Ort beseitigt und den Schaden am Kofferraumdeckel später mit einem Aufkleber (Dänemark-Emblem) verdeckt. Im August 1977 besuchte ich mit meinen Eltern (sie waren zu Besuch bei uns in Farum) unsere Verwandten von Dänemark aus in Stralsund (DDR). Als ich einmal meinen Wagen im dortigen Stadtzentrum parkte, um etwas zu erledigen, hatte man in der Zwischenzeit den Aufkleber als Souvenier entfernt.
Auch in Trondheim mieteten wir wieder eine Holzhütte auf einem Campingplatz, der sehr malerisch am Trondheimsfjorden lag. Trondheim ist die drittgrößte Stadt Norwegens und hat 151.000 Einwohner. Das 1000-jährige Jubiläum der Stadt Trondheim wurde im Jahre 1997 sehr feierlich zelebriert. Für die Besichtigung dieser interessanten Stadt nahmen wir uns leider keine Zeit, denn es drängte uns weiter in Richtung Süden. Deshalb packten wir am folgenden Morgen (11. Tag - Donnerstag, der 30. Juni 1977) unseren Wagen und fuhren frohen Mutes nach Lillehammer (Entfernung: 390 km). Auf dem Weg dorthin kamen wir bei Dombaas ins wunderschöne Gudbrandsdal, das sich von dort über eine Entfernung von 200 km entlang des Flusses Laagen bis nach Lillehammer erstreckt.
Auf dem Weg nach Lillehammer fuhren wir bei Hunder an der Hunderfossen-Talsperre vorbei, die 280 m lang ist und eine Höhe von 16 m hat. Der Damm ist befahrbar. Dahinter liegt ein 7 km langer künstlicher See. Die Staustufe ist auch mit einer Fischtreppe versehen. Am südlichen Ausgang des Gudbrandsdal lag der bekannte Ferienort Lillehammer mit 25.000 Einwohnern. Im Jahr 1994 fanden dort die Olympischen Winterspiele statt. Südlich von Lillehammer gab es am oberen Ende des Mjösa-Sees einen sehr schönen Campingplatz, auf dem wir die letzte Nacht (die 11. Etappe unserer Nordkap-Reise) in einer Hütte verbrachten.
Der Mjösa ist der größte See Norwegens (362 km²) und hat im Frühsommer mit dem Schmelzwasser des Nordens eine sehr schöne, grünliche Farbe. Auf dem See verkehrt ein alter Raddampfer, den ich fotographiert habe. Natürlich lachte auch mein Herz als alter Kanu-Fahrer und ich lud meine Familie zu einer Tour mit dem Ruderboot auf dem Mjösa ein. Ein Foto von damals zeigt mir noch heute, dass das Ganze bei dem entsprechenden Wellengang eine sehr wacklige Aktion war und meine Fahrgäste sehr verängstigt im Ruderboot saßen. Obwohl ich DLRG-Rettungsschwimmer bin, habe ich aus heutiger Sicht zuviel gewagt, denn es fehlten die heutzutage obligatorischen Rettungswesten.
Auf unser folgendes Etappenziel (am 12. Tag - Freitag, den 1. Juli 1977), die norwegische Hauptstadt Oslo (mit 512.000 Einwohnern), freuten wir uns schon sehr. Wir mußten nur eine kurze Strecke von 120 Kilometer zurücklegen. Die Stadt liegt am nördlichen Ende des 100 km langen Oslofjordes. Nicht zu übersehen ist oberhalb von Oslo die Sprungschanze von Holmenkollen. Uns interessierte vor allem die Halbinsel Bygdöy mit den interessanten Schiffsmuseen. Die Fahrt dorthin dauerte 40 Minuten mit einem Boot vom Rathauskai aus. Während dieser Tour gewann man einen sehr schönen Eindruck von der Festung Akershus und dem roten, zweitürmigen Rathaus. Wir fuhren auch an größeren Schiffen vorbei, die im Hafen lagen.
Als erstes besichtigten wir die FRAM ("Vorwärts"). Mit diesem Schiff unternahm der Polarforscher Fridtjof Nansen 1893 eine Forschungsreise von den Neusibirischen Inseln ("Nowaja Semlja") ins Nordpolarmeer, die erfolgreich verlief. 1895 gelangte er bei dem Versuch, von der im Packeis eingeschlossenen FRAM aus mit drei Schlitten, zwei Kajaks und 28 Schlittenhunden auf Skiern den Nordpol zu erreichen, nur bis 86 Grad nördlicher Breite. Mit seinem Begleiter, dem Landsmann Hjalmar Johannsen, mußte er am Franz-Josef-Land ein Jahr überwintern, bis er wohlbehalten wieder nach Norwegen zurückkehren konnte. Auf der ausgestellten FRAM konnte Jochen sich wie ein richtiger Steuermann und Polarforscher fühlen.
Wir hatten großes Glück, denn vor der Museumsinsel lag gerade das imposante portugiesische Segelschulschiff "SAGRES II" vor Anker, das auch besichtigt werden konnte. Dieses Schiff wurde 1938 für die deutsche Kriegsmarine auf der Hamburger Werft BLOHM & VOSS unter dem Namen "Albert Leo Schlageter" gebaut. Nach dem Kriege gehörte es der brasilianischen Kriegsmarine. Auch hier nahm Jochen sehr schnell Besitz von dem Ruder und wir bewunderten das abenteuerliche Leben auf diesem Schulschiff.
Gegenüber dem FRAM-Museum befindet sich in einem weiteren Gebäude, die "KON-TIKI" - ein Floß, das aus Balsaholz gefertigt wurde. Mit diesem Schiff segelte der norwegische Forscher Thor Heyerdahl mit fünf weiteren Besatzungsmitgliedern vom 28. April bis zum 7. August 1947 von der peruanischen Hafenstadt Callao zu den ostpolynesischen Osterinseln. Man kann auch das 14 m lange Papyrusboot "RA II" bewundern, mit dem Thor Heyerdahl und einer Besatzung aus 8 Nationen 1970 den Atlantik bezwungen haben.
Nach diesen vielen atemberaubenden Eindrucken hatten wir nun eine große Sehnsucht nach unserem Zuhause in Kopenhagen. Im Autoradio vernahmen wir unglaubliche Nachrichten über das herrliche Sommerwetter in Dänemark und wir träumten schon vom wunderschönen Sandstrand in Tsvildeleje, der nur ca. 40 km nördlich von Farum an der Nordküste unserer Heimat-Insel Seeland lag. Mich hielt nichts mehr zurück: nach einer eindrucksvollen Abendstimmung mit einer kleinen Pause bei der schwedischen Hafenstadt Uddevalla (mit einer großen Werft am Byfjord) legte ich die Entfernung von 540 km (Oslo bis Farum in Dänemark) ohne große Schwierigkeiten zurück. Ich kann mich noch an die Öresund-Fahre erinnern, die uns am Samstagmorgen, den 2. Juli 1977, gegen 5 Uhr wieder wohlbehalten nach Dänemark (nach einer Fahrtstrecke von mehr als 5.300 km) zurückbrachte. Noch am selben Tag kauften wir uns einen Grill und fuhren zu unserem Traumstrand nach Tisvildeleje, wo wir uns als FKK-Badegäste (wie wir es von Südfrankreich her kannten) in die Wellen stürzten. Mein wunderschöner und erlebnisreicher Urlaub endete erst Dienstag, den 5. Juli 1977, so daß wir noch mehrere, tolle Badetage hatten.
Diese Nordkap-Reise unternahm ich unter der Prämisse meines dreijährigen Aufenthaltes als Koordinations-Ingenieurs bei unserer befreundeten dänischen Firma NIRO ATOMIZER A/S in Kopenhagen. Ich war immer noch Mitarbeiter meiner deutschen Firma WIEGAND Karlsruhe GmbH, die auch meinen Aufenthalt in Dänemark finanzierte. Aber diese Bedingungen änderten sich nach meiner Nordkap-Tour sehr schnell, als NIRO ATOMIZER A/S die französische Konkurrenzfirma LAGUILHARRE in Paris kaufte. Nun mußte ich mich mit meiner Familie entscheiden, ob ich als Gruppenleiter (verantwortlich für den Eindampfanlagenbau) zu NIRO ATOMIZER A/S wechseln oder nach etwas mehr als einem halben Jahr wieder nach Deutschland zurückkehren wollte. Wir entschieden uns für Dänemark und meine neue Firma unterstützte mich beim Kauf eines Reihenhauses, das wir im Oktober 1977 in Alleröd (nördlich von Kopenhagen) bezogen. Fünf Jahre später erlebte ich nach einem anderen, sehr interessanten Tauch- und Bade-Urlaub im Jahre 1982 (siehe Reisebericht "ARUBA und der schönste Strand der Karibik!") ähnlich einschneidende, berufliche Veränderungen, denn nach 6 Jahren als Mitarbeiter des dänischen Konzerns NIRO ATOMIZER entschied ich mich für eine neue Herausforderung als unabhängiger Beratender Ingenieur (Wohnsitz und Büro in Hildesheim).
Fotos und Text: Klaus Metzger
Siehe auch BILDBAND: (IMPRESSIONEN bei Nacht und in der Dämmerung)
3. Über die AUTOPUT zum Windsurfen nach Griechenland
Entsprechend meiner Unternehmungslust (1977 hatte ich mit meiner Familie eine spannende Nordkap-Tour mit einer Gesamtstrecke von ca. 5.200 km unternommen) gestaltete sich unser erster Griechenland-Urlaub 1986 zu einem regelrechten Abenteuer-Urlaub. Mein Bekannter, Generalkonsul Norbert Handwerk, hatte uns sein Ferienhaus "Mäandros" bei Porto Cheli (Peloponnes) kostenlos zu Verfügung gestellt.
Als einzigste Bedingung nannte er die gründliche Reinigung nach der Ankunft und vor der Abreise. Diese Vereinbarung war sicher sehr generös. Aber ich war mir aber nicht darüber im klaren, welcher Aufwand an Geduld und Energie notwendig war, um mit unserem AUDI 100 und den beiden Surfbrettern (von meinem Sohn Jochen und mir) auf dem Dachgepäckträger die Strecke von fast 3.000 km zurückzulegen.
Wir starteten, am Freitag, den 25. Juli 1986, voller Spannung und in aufgeregter Erwartung von Hildesheim aus in das Griechenland-Abenteuer. Jochen und ich freuten uns auf die phantastischen Surfmöglichkeiten in der privaten Bucht, die zum Anwesen "Mäandros" gehörte. Meine erste Frau ULLA hatte keine guten Vorahnungen. Dies führte schließlich zu unserer Scheidung 1989 (nach 20 Jahren Ehe). Allerdings war erst einmal ein Zwischenstopp in München vorgesehen, wo uns die Sekretärin von Herrn Handwerk kleinere Gegenstände für das Ferienhaus übergab.
Von München fuhren wir dann über Salzburg auf die Tauern-Autobahn. Hinter Klagenfurt näherten wir uns der jugoslawischen Grenze. Gegen 23 Uhr erreichten wir bei Ljubljana an der berühmt-berüchtigten AUTOPUT. Diese Transitstrecke führt durch Jugoslawien in Richtung Griechenland/Türkei und hat eine Gesamtlänge von 1.188 km mit zahlreichen Mautstellen. Während des Balkan-Krieges von 1990 bis 2000 konnte die AUTOPUT nicht benutzt werden.
Hinter Ljubljana benötigte ich als Fahrer unbedingt eine Rastpause (nach einer Fahrzeit von ca. 12 Stunden). Ich breitete eine Decke auf dem Boden vor dem Auto aus und versuchte zu schlafen. Wir hatten unseren Wagen aus Sicherheitsgründen in der Nähe eines Campingplatzes geparkt. Dort wurde offensichtlich bei lauter Musik noch gefeiert. Intensives Schlafen war also nicht möglich.
Nach einer Fahrtstrecke von ca. 140 km erreichten wir Zagreb. Dieser Name war mir bereits geläufig, denn am 12. Juni 1981 bin ich auf dem dortigen Flughafen (von Amsterdam kommend) gelandet. Ich arbeitete zu dieser Zeit als Technical Manager in der holländischen Niederlassung der dänischen Ingenieurfirma NIRO ATOMIZER (Sitz in Kopenhagen). In einer neuen Dextrose-Anlage waren mehrere Störungen aufgetreten, die meine beiden Mitarbeiter vor Ort nicht beseitigen konnten.
Mit meiner Erfahrung als Trouble Shooter war ich nun gefordert. Der jüngere Mitarbeiter holte mich mit seinem Mietwagen ab und wir fuhren 200 km entlang der AUTOPUT in südlicher Richtung nach Banja Luka, wo sich die Anlage befand. Die Lösung der Probleme war nicht ganz einfach und ich konnte nur mit einem Provisorium den Betrieb sicherstellen (Anfang November 1981 kam ich noch einmal für 2 Tage, um die Anlage auf den einwandfreien Betrieb umzubauen). Meine erste Anwesenheit dauerte bis zum 17. Juni 1981. Vor meiner Abreise musste ich erst meinen Reisepass bei der Direktion abholen. Das war schon bemerkenswert!
Während der reichlich vorhandenen Freizeit besuchte ich auch das nahegelegene Konzentrationslager JASENOVAC. Dort wurden während des 2. Weltkrieges 600.000 Serben von Kroaten getötet. Die Spannungen aus dieser Zeit führten schließlich auch zum fürchterlichen Balkankrieg, der von 1990 bis 2000 andauerte.
Auf unserer Weiterreise fuhren wir am Samstagmorgen, den 26. Juni 1986, an Belgrad vorbei. Die Stadt machte einen sehr geschäftigen Eindruck auf mich. Nicht mehr als 4 Jahre später war hier und in der weiteren Umgebung"der Teufel los" (der Balkankrieg war ausgebrochen). So etwas Ähnliches habe ich 1972 in Argentinien erlebt. Ich hatte damals in La Plata mehrere sozialistische Freunde. Während des Militärputsches 1976 wurden diese gnadenlos verfolgt und ich weiß nicht, wer von ihnen überlebt hat.
An die Stadt Nis kann ich mich noch einigermassen erinnern. Die Landschaft war sehr angenehm und nicht allzu gebirgig. Doch änderte sich dies allerdings auf dem Weg nach Skopje. Diese Gegend war sehr kurveneich und forderte von mir als Fahrer - nach einer Fahrtstrecke von mehr als 2.000 km - die volle Konzentration. Dazu kam, dass es langsam dunkel wurde und das Weiterfahren einem Blindflug glich!
Vierzehn Jahre später (2000) erlebte ich so etwas mit meiner zweiten Frau, Jutta Hartmann-Metzger, auf unserer Fahrt durch Irland. Infolge eines Streiks mussten wir verspätet mit der Autofähre von Brest (Frankreich) nach Rosslare (Irland) reisen. Wir trafen gegen 18 Uhr in Irland ein und fuhren dann quer durch Irland nach Cleggan an der Westküste, wo wir am frühen Morgen gegen 2 Uhr bei völliger Dunkelheit eintrafen. Und das bei ungewohntem Linksverkehr!
Dies war auch eine ganz besondere Bewährungsprobe für meine zweite Frau JUTTA (wir hatten uns am 20. Februar 1996 unter sehr "mystischen" Umständen kennengelernt und am 20. Februar 1998 standesamtlich in Hildesheim geheiratet). Sie war so gut, dass ich ihr nach der Reise das Zerifikat "Best Co-Pilot of the World" ausstellte.
Mir kam bei der Vorbeifahrt in den Sinn, dass Skopje am 25. Juli 1963 fast vollständig durch ein Erdbeben zerstört wurde. 1070 Todesopfer waren zu beklagen. Mit internationaler Hilfe wurde die Stadt wieder vollständig aufgebaut. Das Erdbeben von Agadir vom 29. Februar 1960 war mit ca. 15.000 Todesopfern die schwerste Naturkatastrophe in der Geschichte Marokkos. Bei dem Erdbeben wurde die Hafenstadt Agadir fast vollständig zerstört und ebenfalls mit internationaler Unterstützung wieder aufgebaut. Wir waren vom 17. bis zum 29. April 2012 in Agadir und konnten von den Zerstörungen keine Spuren mehr finden. Ein Stein fiel mir vom Herzen als wir am Sonntagmorgen, den 27. Juli 1986, gegen 4 Uhr wohlbehalten an der Grenzstation in Thessaloniki ankamen: Wir waren in Griechenland und nun konnte es bei Tageslicht nur noch besser gehen. Auch eine etwas aufwendige Grenzkontrolle ließen wir relativ gelassen über uns ergehen. Später entdeckte ich auf der vorletzten Seite meines Reisepasses einen Eintrag - unsere beiden Surfbretter und unser Auto (AUDI: Kennzeichen HI-LD 866) betreffend. Alles mußte spätestens nach 4 Monaten wieder ausgeführt werden. Wir hielten die Frist ein, denn wir verließen bereits nach 14 Tagen mit unserem Auto und den Surfbrettern das Land. Dafür bekamen wir einen schönen Ausreisestempel.
Eintragung in meinem Reisepass
|
|
Thessalonki war später (2014) noch einmal für JUTTA und mich von Bedeutung. Auch diesmal war es der Flughafen (wie bei Zagreb), der eine Rolle spielte. Gegen 11 Uhr 30 (am Sonntag, den 7. September 2014) kamen wir vom Flughafen Hannover in Thessaloniki an. Von dort brachte uns der Transfer-Bus zum Blue Dolphin Hotel bei Metamorphosis/Chalkidiki. Die Fahrt dauerte 3,5 Stunden. Im letzten Kapitel dieser Reisebeschreibung werde ich detailliert auf diesen einwöchigen und erholsamen Urlaub eingehen.
Nach einer ausreichenden Ruhepause ging die Tour über die gut ausgebaute Autobahn in Richtung Süden weiter und verlief sehr angenehm. Wir fuhren an bekannten Städten wie Katerini, Larisa und Lamia vorbei. Nur die Hauptstadt Athen liessen wir links liegen. Aber auch hier führte uns JUTTA's ausgeprägtes Interesse für die griechische Antike 2006 schliesslich doch hin. Wir nahmen damals an einer Bildungsreise teil, die uns über Delphi, die Akropolis bis nach Mykene brachte.
|
Das Parthenon (2006) |
|
|
Bezeichnenderweise fuhren wir 1986 über die Brücke, die den Kanal von Korinth überquerte, ohne etwas von diesem zu sehen. Erst 2006 - auf dem Weg nach Mykene - bot sich uns im Rahmen unserer Bildungsreise Zeit für eine ausgiebige Besichtung. Zwanzig Jahre früher war ich für diese Schätze der Antike noch nicht sensibilisiert. Dieses erneute Interesse habe ich JUTTA zu verdanken (in meiner Jugendzeit konnte ich nicht genug darüber lesen) So ist auch zu verstehen, dass wir zum Jahreswende 2003/2004 mit einem Nilkreuzfahrtschiff zu den Schätzen des antiken Ägypten unterwegs waren.
|
Kanal von Korinth (2006 |
|
|
Auch auf dem Peloponnes verlief unsere Reise ohne Schwierigkeiten. Nur waren wir infolge der Hitze sehr durstig. Zufällig fanden wir am Strassenrand ein kleines, einsames Kiosk, in dem wir gekühltes Wasser in Plastikflaschen kaufen konnten. Wasser heißt auf griechisch "nero" (wie der römische Kaiser) - lernten wir. Ich habe das nie wieder vergessen.
Kurz vor dem Ziel kam ich an einem leicht abschüssigen Feldweg mit meinen Wagen nicht mehr weiter. Infolge der schweren Beladung saß er auf. Ich entschied mich, den griechischen Pächter Dimitri zu suchen, um ihn um Hilfe zu bitten. Offensichtlich wurden wir erwartet. Er kam mit seinem blauen MAZDA Pickup und wir luden unser Gepäck um. So kam mein AUDI 100 ohne größeren Schaden wieder frei.
Nun waren wir also nach drei Tagen (am Sonntag, den 27. Juli 1986, gegen 15 Uhr) gesund und munter angekommen. Eine derartige Strecke von über 3.000 km hatte ich bisher noch nicht bewältigt. Es waren immer nur Urlaubsfahrten von Karlsruhe nach Frankreich an die Atlantikküste (La Rochelle) und an die Cote D'Azur (Le Lavandou) bei einer Entfernung von ca. 1.000 km. Die bereits erwähnte Tour 1977 zum Nordkap startete in Kopenhagen (wo wir seit Anfang des Jahres lebten) und dauerte 12 Tage mit entsprechenden Übernachtungen. So ließ sich die Gesamtstrecke von 5.200 km relativ leicht bewältigen.
|
Unser AUDI 100 bei ALTA/Nordnorwegen (1977) |
|
|
Die Landschaft um das Ferienhaus kam mir sehr staubig und trocken vor. Es gab zwar Oliven- und Pistazienbäume - diese passten aber zu meinem ersten Eindruck. Auch das Ferienhaus "Mäandros" war prächtig eingestaubt und erforderte einen mehrtägigen Reinigungsaufwand.
Aber diese Enttäuschungen wurden von der unbeschreiblichen Bucht ausgeglichen, die zum Besitz von Generalkonsul Norbert Handwerk gehörte und sich unterhalb des Ferienhauses erstreckte. Und dann gab es noch der Hubschauberlandeplatz, der aber nach meinem Dafürhalten nie benutzt wurde.
Die Bucht war ein ideales Surfrevier. Die Wassertemperaturen waren angenehm und es wehte immer eine tolle Brise. Ein Surfanzug wie in nördlicheren Breiten war nicht erforderlich. Für dieses einzigartige Surfparadies und dafür hatten wir diese lange Anreise auf uns genommen. Das Windsurfen lernten Jochen und ich auf der Insel Samsö im Kattegat.
Dort konnten wir im Sommerhaus dänischer Freunde wohnen und mit deren Ausrüstung im Jahre 1981 das Windsurfen lernen. In meinem damaligen Wohnort Gouda/Holland kaufte ich mir anschließend im September eine komplette Surf-Ausrüstung und verbrachte sehr viel Zeit mit meinem Sohn Jochen (mit einem gebrauchtem Surf-Anzug und einem Kindersegel) auf den "Reeuwijksche Plassen" (eine größere Seen-Platte bei Gouda). Die Samsö-Ferien von 1982 bis 1985 genoss ich mit meinem eigenen Surfbrett, das auch Jochen auslieh. Aber diese Surfmöglichkeiten wurden von unserem Griechenland-Urlaub 1986 übertroffen.
Für die Einkäufe und zur Bank fuhr ins staubige Kranidion. Der vergammelte Supermarkt ist mir auch heute noch in Erinnerung. Manchmal nahm mich Dimitri in seinem MAZDA-Pickup mit. Nach dem Einkauf besuchten wir einmal seine Verwandten in Kranidion, die uns bereits am Vormittag zum Ouzo einluden. Dabei blieb es aber nicht: Es kamen insgesamt 7 bis 8 Stück zusammen. Im Ferienhaus angekommen, begab ich mich erst einmal zum Strand, um meinen Rausch auszuschlafen. Was natürlich bedeutete, dass eine Weile der Hausfrieden schief hing. Meine zweite Frau JUTTA hätte dafür vollstes Verständnis gehabt, den wir lieben es, ab und an eine "Ouzo-Party" zu veranstalten.
Der kleine Hafen Porto Cheli war für uns nahezu bedeutungslos. Einmal spazierten wir mit Dimitri abends über die Uferpromende. Unterwegs traf Dimitri einen griechischen Bekannten, der sich verächtlich über dessen kurze Shorts äußerte. Offensichtlich herrscht auch in diesem staubigen Teil von Griechenland eine strenge Kleiderordnung.
Aber es gab - neben dem ausgiebigen Wassersport in der privaten Bucht - besondere Attraktionen, für die es sich lohnt, auf den Peloponnes zu reisen. Mit Dimitri, Giotta, seinen beiden Söhnen Anastasian und Mellos hatten wir uns trotz Sprachbarrieren angefreundet. Deshalb betätigte sich Dimitri am Donnerstag, den 7. August 1986, als kundiger Reiseführer. Wir packten seine und meine Familie in meinen AUDI 100 (nach deutscher StVO zwei Personen zuviel) und fuhren zum ersten antiken Highlight: dem berühmten Amphitheater von EPIDAUROS mit der antiken Asklepius-Klinik.
|
Eintrittskarte für das Museum "EPIDAUROS" |
|
|
Epidauros ist die bedeutendste antike Kultstätte für den Heilgott Asklepius in Griechenland. Sie liegt auf dem Gebiet der heutigen Ortschaft Lygourio (Gemeindebezirk Asklipio, Gemeinde Epidavros) auf dem Peloponnes in der Region Argolis etwa 30 km von der Stadt Nafplio und etwa 13 km von Palea Epidavros (die kleine Hafenstadt für die An- und Abreise der Heilungsuchenden) entfernt. Sie gehört seit 1988 zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Das imposanteste und auch heute noch auffälligste Bauwerk von Epidauros ist zweifellos das große, in einen Hang gebaute Theater mit grandiosem Blick auf die Berglandschaft der Argolis. Es stammt aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. (~ 330 v. Chr.), also aus spätklassischer Zeit und soll nach Pausanius das Werk eines Polyklet sein. Besonders die große, halbkreisförmige Zuschauertribüne (koilon), die nach einem Umbau um etwa 170/160 v. Chr. bis zu 14.000 Personen Platz bietet, beeindruckt auch heutige Besucher. Wir begeisterten uns an dem Besteigen der Stufen, die den einzigartigen Ausblick ermöglichkeiten.
Das Theater verfügt über eine exzellente Akustik, sodass man auch von den obersten Reihen jedes Wort verstehen kann. Erreicht wird dies vermutlich durch die nach unten gewölbte Form der Sitzsteine. Ein beliebter „Akustik-Test“ im Theater von Epidauros ist das Fallenlassen einer Münze auf die Steinplatte im Zentrum des Bühnenrings, das auch vom obersten Rang problemlos gehört werden kann. Seit 1952 werden hier wieder regelmäßig klassische Dramen vorgeführt und ziehen – wie damals – Zuschauer aus ganz Griechenland in den Sommermonaten nach Epidauros.
Bedauerlicherweise sollte ich dieses phänomenale Bauwerk aus griechischen Antike während unserer Bildungsreise 20 Jahre später nicht mehr wiedersehen. Die zweite Station war das bekannte, historische Mykene. Es war schon sehr heiß geworden und wir mussten unter diesen Bedingungen ca. 50 km in nordwestlicherRichtung zurücklegen. Giotta, die mit einem Krebsleiden zu tun hatte, blieb auf dem schattigen Parkplatz im Wagen zurück, während sich der Rest der Mannschaft in die griechische Frühgeschichte begab.
Mykene war in vorklassischer Zeit eine der bedeutendsten Städte Griechenlands. Nach ihr wurde die mykenische Kultur benannt. Die Stadt lag nördlich der Ebene von Argos auf einer Anhöhe. Von hier überschaute und kontrollierte man den Landweg zwischen südlichem südlichem Peloponnes und dem Isthmus von Korinth, der damals die peloponnesische Halbinsel mit dem übrigen Festland verband. Seit 1999 gehört Mykene gemeinsam mit Tiryns zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Erhalten und ausgegraben sind heute u. a. die Ruinen der mykenischen Oberstadt. Erwähnenswert sind die Reste der zyklopischen Ringmauer und das Löwentor. Es wurde benannt nach den zwei Löwen, die auf einem Relief über dem Toreingang dargestellt sind, und bildete den Hauptzugang zur Burg. Vermutlich wurde das Tor um 1250 v. Chr. gebaut. Ein zweites kleineres, aber nicht zur Gänze erhaltenes Tor ohne Schmucksteine befindet sich im nördlichen Bereich der antiken Anlage.
|
Das Löwentor (2006) |
|
|
Von großer Bedeutung sind zwei große Grabzirkel (A und B), die durch Stelen gekennzeichnet waren. In den Grabzirkeln fanden sich jeweils eine ganze Reihe von Schachtgräbern mit sehr reichen Grabbeigaben wie Terrakotten, Tongefäßen, goldenen Masken, Schmuck aus Goldblech usw. In fünf Schachtgräbern waren 17 Gebeine (überwiegend von Männern) zu finden. Grabzirkel A, der bereits von Heinrich Schliemann entdeckt wurde, kam bei späteren Erweiterungen der Burganlage in die Burgmauer.
Grabzirkel B ist erst Anfang der 1950er Jahre ausgegraben worden. In ihm fanden sich z. T. noch ältere Gräber als im Grabzirkel A. Sie stammen aus dem späten 17. oder frühen 16. Jahrhundert v. Chr. und stehen somit ganz am Anfang der mykenischen Periode. Die frühesten Gräber des Grabrunds A stammen ungefähr aus der Mitte des 16. Jahrhunderts v. Chr.
Diese Eindrücke im Jahre 1986 waren für mich so überwältigend, dass es nur eines Katalysators in der Person meiner zweiten Frau JUTTA bedurfte, um mich intensiv mit der Antike - allerdings mit zehnjähriger Verspätung (1996 hatte ich die "mystische" Begegnung mit JUTTA in Hildesheim) - zu befassen. Nun erst machten für mich die Reisen nach RHODOS (2001), nach KRETA (2005) und die "Spurensuche in der griechischen Antike" (2006) einen Sinn. Auch ins außereuropäischen Ausland unternahmen wir Bildungsreisen: Indien (2007), Kenia (2009) und China (2011).
Den Abschluss unserer Kulturreise bildete die Hafenstadt Nafplio. Dafür mussten wir nur 20 km in südlicher Richtung zurücklegen. Dimitri gab die Anweisung, auf die Festung Palamidi zu fahren. Von dort hatte man eine beeindruckende Aussicht auf die Stadt, die Badestrände und den Hafen. Während der Bildungsreise (2006) waren wir auch in Nafplio. Ich hätte JUTTA gerne diesen Ausblick gezeigt. Leider besuchten wir nur die Strassen in Hafennähe!
Die eigentliche Stadt hat 14.203 Einwohner (2011) und war von 1829 bis 1834 die provisorische Hauptstadt von Griechenland. Die Gemeinde Nafplio wurde zuletzt 2011 durch Eingemeindungen erheblich vergrößert und beherbergt 33.356 Einwohner.
Nafplio wurde während der Griechischen Revolution ein Jahr lang von griechischen Revolutionstruppen belagert und schließlich im Dezember 1822 erobert. Von 1829 bis 1834 war Nafplio nach Ägina (1827–1829) die zweite Hauptstadt des modernen Griechenland nach der Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. 1833 wurde die Stadt Residenz von Otto von Bayern, der griechischer König wurde. Im Jahr 1834 zog der Hof nach Athen, das seither die griechische Hauptstadt ist.
Nach soviel Geschichte und beträchtlichen Temperaturen suchten wir in einem kleinen Wäldchen unterhalb der Festung einen kühlen Picknick-Platz. Die ausklappbaren Campingstühle hatten wir dabei und unsere Damen waren schon vor Reisebeginn mit der passenden Kost beschäftigt. Auch für kühle Getränke war gesorgt.
|
||||
|
|
|
|
|
Das Ferienhaus "Mäandros" hatte noch einen weiteren Reiz, denn von der Terrasse konnte man am frühen Morgen den Sonnenaufgang über der Bucht beobachten.
Seit meinen Reisen in Südamerika (ab 1972) konnte ich mich für Sonnenauf- und Untergänge begeistern. Unter dem Titel "Impressionen" habe ich einen Bildband konzipiert (mit Aufnahmen rund um den Globus).
Am Montag, den 11. August 1986, war unsere schöne und eindrucksvolle Ferienzeit beendet. Mit dem Pächter Dimitri und seiner Familie hatten wir uns angefreundet. Sie luden uns ein, Weihnachten bei ihnen in Athen zu verbringen. Das Schicksal hat es dann aber anders mit uns gewollt: Ich erlebte einen wirtschaftlichen Absturz, der 1989 zu unserer Scheidung führte. Erst JUTTA half mir ab 1996 wieder Ordnung in mein Leben zu bringen. Als wir gemeinsam auf unserer Bildungsreise 2006 durch Griechenland auch Athen besuchten, hatte ich das freundliche Pächter-Ehepaar - zu meinem Bedauern - vergessen.
Auf der Rückreise kamen wir zügig voran (auch weil wir die schwierige Bergetappe von Thessalonki nach Skopje am Tag passieren konnten). Am späten Diernstagabend, den 12. August 1986, waren wir bereits auf der Tauern-Autobahn. Überraschenderweise fand ich noch ein Privat-Quartier in Flachau. Bis München waren es nur noch 200 km. Wir kamen verschwitzt und verdreckt an und waren am Mittwochmorgen, den 13. August 1986, wie verwandelt, denn die Dusche und der Kleiderwechsel wirkten Wunder.
In München lieferte ich Generalkonsul Norbert Handwerk drei 10-Liter-Kanister Olivenöl aus seinem griechischen Anwesen ab. Über 1,5 Stunden unterhielten wir uns über unsere Ferienerlebnisse und seinen Schwierigkeiten mit den Pächtern, die vor Dimitri sein Plantage betreuten. Er wußte von Giotta's Krebskrankheit und versuchte, ihr zu helfen. Von ihm erfuhr ich auch, dass er den blauen MAZDA Pickup Dimitri geschenkt hat.
Als wir das Büro seiner Produktionsfirma Inselfilm gegen 12 Uhr verliessen, ahnte ich nicht, dass wir uns - wie Dimitri und seine Famlie - ein letztes Mal gesehen hatten (er starb 1991 an Herzversagen). Die Weiterreise ist schnell erzählt: In Söllingen bei Baden-Baden holten wir die Schwiegermutter und fuhren dann weiter nach Hildesheim. Dort kamen wir am Abend des 13. August 1986 wohlbehalten an. Eine spannende und gefährliche Abenteuerreise hatten wir heil überstanden.
4. IRLAND - Wiedersehen nach 20 Jahren!
Kurz nachdem ich von meiner USA-Rundreise im Februar 1974 (siehe Reisebericht "USA" ) zurückkam, wechselte ich wieder in mein ursprüngliches Aufgabengebiet (Eindampfanlagentechnik für die internationale Milchwirtschaft) bei meiner Firma WIEGAND GmbH Karlsruhe zurück. Mit den Ländern in Südamerika, die nun zu meinem Verantwortungsbereich gehörten, war ich teilweise bereits durch meine 1. Südamerika-Reise 1972 (siehe Reisebericht "Argentinien" ) vertraut. Neu waren für mich die europäischen Länder Großbritannien und Irland. Bereits nach kurzer Zeit entstand insbesondere mit der grünen Insel Irland eine ganz innige Beziehung.
Aus heutiger Sicht - also nach mehr als 30 Jahren - kann ich diese "Liebe auf den ersten Blick" viel besser erklären, als es mir damals möglich gewesen wäre. Dabei half mir auch unsere langgeplante Irland-Reise (vom 30.August bis zum 10. September 2000) mit meiner 2. Frau JUTTA in die ärmste Gegend Irlands - nach Connemara (westlich von Galway). Es war eine richtige PKW-Rallye mit der irischen Fähre vom französischen Brest (wegen eines Streiks war die Abfahrt von Cherbourg nicht möglich) nach Rosslare in Irland. Und dann mitten in der Nacht (wegen der Verspätung durch den Streik von ca. 8 Stunden) quer durch Irland nach Cleggan (bei Clifden) an der Westküste. Die Rückfahrt gestaltete sich etwas einfacher, in dem wir über Großbritannien wieder nach Hause fuhren. Wir bewährten uns beide als Super-Team (Jutta erhielt von mir anschließend ein Zertifikat "Best Co-Pilot of the World"!). Die detaillierte Geschichte dieses Abenteuer-Urlaubes folgt später!
Es war die Freiheit und die Gelassenheit, die ich in Irland wiederfand und die meiner eigenen Mentalität sehr entgegenkam. Schließlich liebte ich es, bereits im Alter von 15 Jahren, eigene Touren alleine mit meinem Kanu auf den Altrhein-Armen meiner näheren Umgebung (ich bin in Brühl bei Mannheim aufgewachsen) zu unternehmen und - je nach Lust und Laune - auf kleinen, einsamen Inseln zu übernachten. Und dann kamen die spannenden Reisen in Südamerika (1972). In über 30 Reisen (mit einer Dauer bis zu 3 Monaten 1979 während der Montage und Inbetriebnahme bei Waterford Coop. in Dungarvan) für den Zeitraum von 1974 bis 1980 lernte ich dieses herrliche Land in allen Facetten kennen und schloss Freundschaften mit typischen Vertretern dieser irischen Mentalität, wie z.B. mit Jim O'Connor in Dungarvan.
Schon meine erste Reise nach Irland (vom Dienstag, dem 15. April bis Dienstag, dem 24. April 1974) verlief nach demselben Muster, das sich während der folgenden Reise wiederholte. Diesmal flog ich von Frankfurt nach Shannon an der Westküste Irlands. Ursprünglich wurden dort die Propeller-Flugzeuge vor ihrem Flug in die USA aufgetankt. Mit der Einführung der Düsenverkehrsflugzeuge war dies nicht mehr erforderlich. Man lockte nun die USA-Touristen zu einem Zwischenstopp auf der Heimreise in den reichhaltigen Duty Free - Bereich des Flughafens von Shannon. Für mich war er der angenehmste irische Flughafen, denn ich konnte mich - nachdem ich die größere Stadt Limerick mit 54.000 Einwohnern (2002) gefahrlos passiert hatte - auf einsamen, schmalen Strassen an den Linksverkehr gewöhnen.
Es gab nicht allzuviel Gegenverkehr, nur manchmal blockierten Kühe, die von einem Weidegrund zum nächsten transportiert wurden, die Strasse. Mir begegnete auch ein "Cowgirl" mit Pferd. Man mußte also immer konzentriert und trotzdem entspannt fahren. Dann und wann tauchten verlassene Ruinen auf, die ursprünglich eine Kirche, eine Hütte oder vielleicht auch ein größeres Anwesen darstellten. Nach den Pausen, in denen ich z.B. Fotos zur Erinnerung aufgenommen hatte, galt es achtsam zu sein, denn sehr schnell begann man wieder im gewohnten Rechtsverkehr zu fahren. Die Lichthupe des entgegenkommenden Fahrzeugs verwies einen - nach einer Schrecksekunde - aber sofort wieder auf die richtige Spur. Mit der Zeit ging mir das Linksfahren in Fleisch und Blut über. Selbst nach 20 Jahren Pause hatte ich im Jahre 2000 mit meinem eigenen Fahrzeug (mit Linkssteuerung) in Irland keine Schwierigkeiten.
Als störend empfand ich die relativ hohen Steinmauern, die die Fahrbahn auf diesen kleinen Strassen auf beiden Seiten begrenzten. Diese machten es unmöglich, sich über den Verlauf der Strecke im voraus zu orientieren. Sehr unangenehm waren kleine, gewölbte Brücken, nach denen die Strasse eine Rechts- oder Linkskurve machte.
Nach dem Satz mit dem Auto, den die Brücke verursachte, musste man auch noch die richtige Kurve finden (in solchen Situationen ähnelte das Autofahren mehr dem Ski-Abfahrtslauf - aber ohne Schnee).
Die irische Natur auf diesem Weg in den Süden Irlands (nach Killarney) war anders als ich es von meiner süddeutschen Heimat her gewöhnt war. Überall sattes Grün in einer hügeligen Landschaft. Auf der Weide, die wegen des milden Klimas (an der Westküste fließt der warme Golfstrom vorbei und vereinzelt sieht man Palmen) ganzjährig benutzt werden kann, grasten Kühe, Schafe und vereinzelt auch Pferde. Und ganz selten traf ich Menschen - selbst nicht in den kleineren Ortschaften, die ich passierte.
Manchmal war es wirklich notwendig, sich nach dem richtigen Weg zu erkundigen, denn die Beschilderung war damals miserabel. Da ich niemand fragen konnte, musste ich mich auf meinen 6. Sinn verlassen und meistens klappte es dann auch, den richtigen Weg wieder zu finden. Eine richtiggehende Katastrophe waren Nachtfahrten. Diese sollte man tunlichst vermeiden. Bei meiner Nachtfahrt quer durch Irland im Jahre 2000 konnte ich mich nur auf meine alten, irischen Orientierungsfähigkeiten verlassen, um uns sicher und wohlbehalten ans Ziel - nach Cleggan in Connemara an der Westküste Irlands - zu bringen.
Bereits auf meiner ersten Tour begegnete ich "Travellers", die mit Pferdegespannen und geschlossenen Wagen übers Land zogen. Dies sind keine Zigeuner - obwohl sie diesen im Verhalten ähneln. Man nennt sie das "Fahrende Volk Irlands". Insgesamt soll es 4.000 Traveller-Familien mit ca. 18.000 Mitgliedern geben. Die "Travellers" wurden erstmals im Jahre 1175 urkundlich erwähnt. Ihre Sprache ist Shelta oder Gammon (eine Mischung von Gälisch, Englisch und Romanisch). Da viele Traveller ihren Unterhalt mit "Kesselflicker-Arbeiten" verdienen, heißen sie in Irland auch "Tinker".
Da mich das Land, die Menschen und deren Musik sehr schnell fasziniert haben, legte ich mir eine Schallplatten-Sammlung der irischen Folk-Song-Gruppe "DUBLINERS" zu. Eines der von ihnen gesungenen, herrlichen Lieder handelt von einem "Tinker". Da ich meine DUBLINERS auch unterwegs im Auto hören wollte, überspielte ich die schönsten Lieder auf eine Kassette. Und von dieser Kassette habe ich mir vor einigen Jahren eine CD hergestellt, damit ich sie auch heute noch mit der Musik-Anlage in meinem OPEL COMBO Tour (einem sehr praktischen Van, den ich nun schon über 6 Jahre ohne Störungen fahre) genießen kann.
Am Samstagabend, den 23. Oktober 1993, lud mich mein Sohn Jochen in Berlin zu einem DUBLINERS-Konzert in einem Zelt in der Nähe des Kongreßgebäudes ("Schwangere Auster" - die 1980 teilweise einstürzte) ein. Es begleiteten uns damals unsere Freundinnen Iris und Sabine. Ein großartiger Abend! Drei, vier Lieder kamen mir bekannt vor. Die Veranstaltung begann um 20 Uhr und endete gegen 23 Uhr. Bilder "Irland"
Aber viele Lieder handeln auch vom Befreiungskampf aus der Knechtschaft der Engländer, die das arme Land ausgebeutet haben. Und natürlich auch von der IRA. In diese "Troubles" wurde ich bei meinen Reisen nach Nord-Irland hineingezogen (aber davon später). An dieser Stelle möchte ich mich ein wenig mit der irischen Geschichte befassen, denn nur so kann man die irische Mentalität, den Stolz und die Gelassenheit (manche sagen: Faulheit) besser verstehen und diese - je nach der eigenen Einstellung - sympathisch finden oder ablehnen.
Zuerst kamen die Kelten im 1. Jahrtausend v. Chr. (zwischen der Bronze- und Eisenzeit) nach Irland und das Land nahm den keltischen Charakter an. Die Griechen und Römer erreichten die grüne Atlantik-Insel nicht. Das Christentum brachte St. Patrick im Jahre 432 n. Chr. Er kehrte hierher zurück, wohin man ihn vorher entführt hatte.
Es folgte im 6. und 7. Jahrhundert eine schnelle Ausbreitung durch irische Mönche. Diese kamen im 6. Jahrhundert als Missionare bis nach Schottland und auf das europäische Festland.
Um 795 n. Chr. überfielen Wikinger die Insel Lambay vor der Küste Dublins, um dann weitere Siedlungen in Irland zu gründen (Dublin, Waterford, Wexford..). Die Normannen aus England kamen erstmals 1170, um Dermot, dem späteren König von Leinster, zu helfen. Eine Festigung der Macht der Tudors in Irland erfolgte unter Heinrich VIII (1491 bis 1547). Mit den Stuart's (Jakob I von England) wuchs der Einfluß des Protestantismus in Irland. Viele Schotten wanderten damals nach Ulster (heute Nord-Irland) aus. Am 23. Oktober 1641 kam es zum ersten Aufstand in Irland. Im Spätsommer 1649 landete Oliver Cromwell mit 30.000 Mann im abtrünnigen Irland.
Die aufrührerischen Iren wurden besiegt und deren Grundbesitz wechselte von den Katholiken in die Hände der Protestanten. Im Jahre 1724 griff Jonathan Swift (er wurde 1667 in Dublin geboren und war dort als Dekan an der St. Patricks-Kathedrale tätig) in einer Reihe von Briefen die englische Regierung an. Im Jahre 1846 gab es in Irland eine große Hungersnot, die durch die Kartoffelfäule entstanden ist. Zwischen 500.000 und einer Million Menschen starben. Über 1,5 Millionen Iren wanderten aus nach Übersee (Kanada, Australien und die USA).
Seit 1841 war die Einwohnerzahl von 8,1 auf 6,5 Millionen nach der Hungerkatastrophe gesunken. Die irischen Pächter mußten auch während der Hungersnot die Pacht in Form von Getreide und tierischen Produkten nach England exportieren.
In den Jahren von 1870 bis 1903 erfolgte der Rückkauf des Landes durch irische Pächter (über 300.000 Iren kauften bis 1920 10 Millionen Morgen). Am 24. Oktober 1916 kam es beim General Post Office zum Osteraufstand in Dublin. Obwohl militärisch fehlgeschlagen, kann dies als die Wende in Richtung der irischen Unabhängigkeit betrachtet werden. 1922 kam es zur Gründung des Freistaates Irland, nachdem 1921 Waffenstillstand mit London geschlossen wurde. Es erfolgte die Aufteilung in 26 Grafschaften (counties) mit 90 Prozent der Katholiken im Freistaat Irland und 6 Grafschaften mit einer protestantischen Mehrheit als Nord-Irland im britischen Königreich. In Irland leben heute 4 Millionen und in Nord-Irland 1,5 Millionen Einwohner (davon 56% Protestanten und 44% Katholiken).
Im Sommer 1922 begann der Bürgerkrieg zwischen Unterstützern und Gegnern der anglo-irischen Vereinbarung, die zum Freistaat Irland (dem Vorläufer der heutigen Republik Irland) geführt hatte. Der Krieg dauerte 11 Monate.
In dem bekannten Spielfilm "Michael Collins" (Hauptdarsteller Liam Neeson) wird der Freiheitskampf von 1916 bis 1922 sehr realistisch beschrieben. Da der irische Freiheitsheld Michael Collins für die anglo-irische Vereinbarung war (und diese teilweise mitverhandelt hatte), wurde er am 22. August 1922 heimtückisch in der Nähe von Cork (wo er geboren war) ermordet.
Michael Collins war auch der Mitbegründer der IRA (Irish Republican Army) und deren Organisator als Guerilla-Armee. 1949 verließ Irland das britische Commonwealth. Seit 1955 ist Irland Mitglied der UNO und 1973 erfolgte der Eintritt in die EWG.
Nach diesem Ausflug in die Geschichte lassen sich viele Aspekte im immer noch armen Irland sehr viel besser verstehen. Beispielsweise flossen mit dem Eintritt in die EWG im Jahre 1973 beträchtliche finanzielle Mittel in den Aufbau der Molkereiwirtschaft, da man die idealen Bedingungen Irlands als Weideland erkannte und fördern wollte. Und so war ich nun als Projekt-Ingenieur für WIEGAND-Eindampfanlagen unterwegs, um als "Trouble-Shooter" Fehler und Störungen in neuinstallierten Anlagen zu beseitigen. Eine derartige Anlage befand sich bei der Firma CADBURY in Rathmore - einem kleinen Ort ca. 20 km östlich von Killarney gelegen.
Ich hatte auf meiner 1. Irland-Reise sehr großes Glück: Erstens liegt Killarney in einer schönsten Gegenden Irlands. Die 179 km lange Panorama-Küstenstraße "Ring of Kerry" startet in Killarney. Und zweitens gibt es hier das exquisite 5-Sterne-Hotel EUROPE. Das Hotel gehört zur deutschen LIEBHERR-Gruppe. Im Jahre 1958 begann die Firma LIEBHERR mit einer Fertigung bei Killarney. Da die Besucher kein passendes Quartier fanden, baute LIEBHERR das Hotel EUROPE, das sehr idyllisch am Lough Leane liegt. Heute werden bei LIEBHERR in Irland Container-Krane hergestellt (460 Mitarbeiter und 120 Millionen Euro Umsatz).
Im Hotel befanden sich zu dieser Zeit sehr viele Amerikaner irischer Abstammung. Das störte mich aber nicht. Im Gegenteil - sie bestärkten mich beim ausgezeichneten Abendessen in meiner gehobenen Stimmung, wie ich sie in einer ähnlichen Art und Weise erstmals am 22. Februar 1974 im Restaurant des Terminals am Flughafen Boston erlebt hatte (siehe Reisebericht "USA" ). Das Steak schmeckte hier genauso gut wie 1972 in Argentinien und der Rotwein war ausgezeichnet. Sehr gerne aß ich dazu "French Fried Onions" - eine Delikatesse, die es nur in Irland gab. Es waren umhüllte und gebackene Zwiebelringe.
Ich sprach bereits vom Muster, das sich in Irland (und auch in Nord-Irland) fast immer wiederholte: Sehr schlechte Arbeitsbedingungen in den Molkereien und gute Übernachtungs- und Verpflegungsmöglichkeiten in den Hotels (Hotel Europe in Killarney, Jury's Hotel in Cork, Newpark Hotel in Kilkenny, Gresham Hotel in Dublin und das Belmont House in Banbridge bei Belfast). Das war äußerst wichtig für die eigene Moral. Gerade am Beispiel CADBURY Rathmore war dies sehr deutlich zu erkennen, denn ich war bei der Fehlersuche völlig auf mich alleine gestellt. Nach einigen Tagen fand ich die Ursache. Ich entdeckte aber auch im Nachbargebäude eine Herstellung der Rohmasse für die CADBURY-Schokoladenherstellung in England. In die offenen Anmischbehälter konnte alles fallen (auch Ratten und Mäuse). Die Masse wurde zwar anschließend in Öfen erhitzt - trotzdem esse ich seit dieser Zeit meine geliebte CADBURY-Schokolade nicht mehr. Es war in diesem Betrieb alles ungeheuer schmutzig und wenig hygienisch. Derartige, extreme Bedingungen begegneten mir in Irland immer wieder. Die Menschen waren immer noch sehr arm und hatten wenig Gespür für Sauberkeit entwickelt.
Den Schmutz konnte man ja im nächsten Pub mit einem Glas Guinness hinunterspülen. So haben es wohl die Bauern gehalten, die mit dem Eselskarren ihre Milch in der Molkerei ablieferten und dann den restlichen Tag in der Kneipe verbrachten (der Esel wartete seelenruhig mit seinem Anhänger und den leeren Milchkannen vor der Eingangstür). Was ist Guinness?
Ein braunes, alkoholisches Getränk, das für mich ungenießbar war. Im Jahre 1759 pachtete Arthur Guinness eine Brauerei am St. James Gate in Dublin auf 9.000 Jahre bei einem Zins von 45 Pfund/Jahr. Ursprünglich war Guinness ein Porter-Getränk der Lastenträger vom Covent Garden in London. Der Gesamtumsatz betrug 1995 46,8 Milliarden Pfund (11 Milliarden Mark).
Ich liebe folkloristische Musik. Deshalb besuchte ich bereits während meiner 1. Südamerika-Reise 1972 immer gerne die "Pena Folkloricas". Dort wurden zu Guitarren-Musik einheimische Lieder gesungen. Das Gegenstück dazu fand ich in Irland. Dort nannte man das Ganze "Sing-Song". Und die Amerikaner in Killarney liebten diese Veranstaltungen in den Pub's genauso wie ich.
Neben meinen Reisen als "Trouble Shooter" und als der Leiter der Montage und Inbetriebnahme verschiedener Anlagen war ich auch als Verkaufsingenieur für WIEGAND-Eindampfanlagen in Irland und Nord-Irland unterwegs. Unser Verkaufsteam bestand meistens aus drei Personen:
Derek Cornwell (der zuständige Vertreter aus London), Hans Justesen (Niro Atomizer A/S, Kopenhagen) und ich. Als routinierter Linksfahrer (Derek war Engländer) übernahm er immer die Chauffeur-Funktion.
So reisten wir quer durch Irland, um an einem Tage mehrere Kunden zu besuchen. Da wir gemeinsam nach Hause flogen, übernahm ich gerne die Tradition von Derek Cornwell: meine 1. Bestellung bei der Stewardess war immer ein Gin-Tonic mit Eis. Derek empfahl mir auch den ausgezeichneten irischen Räucher-Lachs (Smoked Salmon). Auch daraus wurde eine richtiggehendeTradition: Bei meinen Reisen vor Weihnachten kaufte ich am irischen Flughafen "Smoked Salmon", der transportsicher verpackt war.
Zu Weihnachten bei uns zu Hause war dann diese Delikatesse mit Meerrettich-Sauce ein besonderes Highlight. Neben dem Flughafen Shannon, gibt es noch den größeren Flughafen bei Dublin und einen kleineren bei Cork. Selten benutzte ich den Flughafen Belfast in Nord-Irland. Den Flughafen Dublin wählte ich ungern, denn ich musste erst das weitläufige Dublin in Richtung Süden durchqueren, bevor ich meine Kunden besuchen konnte.
Der Flughafen Cork lag zwar sehr viel günstiger. Dort konnte es aber passieren, dass wegen der starken Seitenwinde (wegen der Meeresnähe) der Pilot Schwierigkeiten mit der Landung hatte. In einem Falle klappte die Landung erst nach dem 3. Anflug.
Aus heutiger Sicht kann ich die Benutzung der Fähre nach Irland nur für private Reisen empfehlen. In der Zeit vom 26. August bis 30. August 1974 reiste ich mit Dr. Barker (einem Kollegen von Derek Cornwell) erst mit seinem Landrover durch Süd-England, wo wir mehrere Kunden besuchten.
So war es eigentlich naheliegend, die Reise nach Irland mit der Fähre von Swansea (Wales) nach Cork an der Südküste zurückzulegen, da am Donnerstagmorgen, den 29. August 1974, ein wichtiger Termin bei CADBURY in Rathmore (bei Killarney) vorgesehen war. Die Nacht auf der Fähre war die reinste Katastrophe, denn ich konnte wegen des starken Seegangs kaum schlafen. Ich kam wie "gerädert" zu dem Treffen in Rathmore und es kostete mich große Anstrengung, mich zu konzentrieren.
Daraus habe ich gelernt: Geschäftliche Termine und Reisen mit der Fähre nach Irland passen nicht zusammen!
Als die Fähre sich am Morgen des 29. August 1974 dem Zielhafen Cork näherte, fuhren wir an dem kleinen Hafen Cobh vorbei. Mit diesem Namen sind zwei der größten Schiffsunglücke verbunden. Am 11. April 1912 legte hier das als unsinkbar geltende Passagierschiff TITANIC an, bevor es drei Tage später vor Neufundland einen Eisberg rammte und sank. Über 1.500 Menschen ertranken bei diesem Unglück. Am 7. Mai 1915 wurde am "Old Head of Kinsale" das amerikanische Passagierschiff LUSITANA von einem Torpedo des deutschen U-Boots U20 getroffen und sank in kürzester Zeit. Bei dieser Katastrophe starben 1.198 Menschen. Auf dem Friedhof von Cobh wurden 150 Opfer des Schiffsunglücks in einem Massengrab beerdigt. Während der großen Hungersnot im 19. Jahrhundert sind viele Iren über Cobh ausgewandert.
|
Ich sprach bereits über die problematischen Reisen nach Nord-Irland. Vom Montag, den 28. Juli 1975, bis zum Dienstag, den 12. August 1975, verbrachte ich mit zwei Mitarbeitern (Monteur Glöckner und Regelungstechniker Müller) eine sehr schwierige Zeit in Banbridge (ca. 30 km südlich von Belfast).
Unsere Aufgabe war die Inbetriebnahme einer neuen Eindampfanlage bei ARMAGHDOWN Creameries. Wir flogen zuerst nach Manchester, um bei der englischen Molkerei MMB Maelor in Wrexham (bei Chester) unseren Werkstattwagen (ein umgebauter FORD Transit) abzuholen. Dann fuhren wir mit diesem Fahrzeug über den Motorway nach Norden bis nach Carlisle, um dann über die A 75 zum englischen Fährhafen Stranraer zu gelangen. Von dort brachte uns die Fähre nach Larne in Nord-Irland.
|
|
|
Nun war uns bereits sehr mulmig zu Mute, denn wir mussten durch Belfast fahren, um zu unserem Ziel in Banbridge zu gelangen. Das klappte ohne Probleme. In Banbridge fanden wir ein ausgezeichnetes Quartier im Belmont House - einem früheren Herrensitz mit einer ausgezeichneten Küche. Während in Irland und auch Nord-Irland normalerweise der charakteristische Spruch galt:
"Letztes Jahr fiel der Sommer auf einen Montag!", waren wir diesmal in eine ungewöhnliche Hitzeperiode geraten. Deshalb konnte im Belmont House auch nur an jedem 2. Tag gebadet oder geduscht werden. Diese Zeit in Nord-Irland war wirklich schrecklich. Jede Nacht hörten wir von anderen Terror-Anschlägen (einmal wurde eine irische Musiker-Truppe mit 4 Personen auf der Rückfahrt nach Dublin ermordet und in einer anderen Nacht gab es 2 Tote).
Die "Troubles" endeten erst 1993 mit einer Feuerpause. Die IRA akzeptierte am 31. August 1994 die bedingungslose Waffenruhe (nach 25 Jahren des bewaffneten Kampfes). Im Februar 1996 beendete die IRA den Waffenstillstand durch ein Attentat in London. Die politische, irische Partei Sinn Fein blieb in der Folgezeit von den Nordirland-Verhandlungen ausgeschlossen. Der Engländer Tony Blair nahm nach seinem Regierungsantritt im Mai 1997 das Gespräch mit der Sinn Fein wieder auf. Mit dem "Stormont-Abkommen" vom 10. April 1998 sollte der Konflikt beendet werden und die Entwaffnung aller paramilitärischen Verbände innerhalb von 2 Jahren erfolgen.
Das Werksgelände war umzäunt und wir pendelten nur zwischen dem Belmont House, das oberhalb auf einem Hügel lag, und der Molkerei. Nach Belfast trauten wir uns nicht. Da wir aber trotzdem einen Badeausflug bei dem heißen Wetter an die Küste nach Newcastle machen wollten, mieteten wir uns einen Leihwagen. Aber je mehr wir uns der irischen See näherten, um so nebliger wurde es. Den Strand konnte man nicht sehen, denn er wir im Nebel verhüllt. Man hörte nur Stimmen. Da die irische See auch zu dieser Zeit relativ kühl war, kam es dort zur Nebel-Bildung. Zum Baden war es uns definitiv zu kalt und wir fuhren bei herrlichem Sonnenschein wieder landeinwärts in die Mourne Mountains. Und dort konnte man die Auswirkungen der Trockenperiode sehr deutlich erkennen, denn das Gras, das normalerweise saftig grün ist, war ausgesprochen braun.
Da die Inbetriebnahme bei ARMAGHDOWN Creameries rechtzeitig abgeschlossen war, fuhren wir mit dem Werkstattwagen noch nach Artigavan (in der Nähe von Londonderry - damals ein sehr heißes Pflaster, da es an der Grenze zur Republik Irland lag). In der LECKPATRICK Creamery führten wir einige Servicearbeiten durch. Am Dienstag, den 12. August 1975, nahmen wir uns einen Leihwagen bis zum Flughafen Belfast, um von dort wieder nach Deutschland zu fliegen. Als wir im Flugzeug saßen, fiel uns ein Stein vom Herzen. Es war zwischendurch in Nord-Irland so schlimm, dass wir überlegten, unsere Inbetriebnahme-Arbeit abzubrechen und nach Deutschland zurückzukehren.
Der Werkstattwagen blieb in der Molkerei LECKPATRICK Creamery bis zum Montag, den 26. April 1976, stehen. Zusammen mit dem Monteur Volkmann holte ich den FORD Transit an diesem Tage ab, um an der eindrucksvollen Westküste Irlands (die Donegal Bay!) entlang in den Süden Irlands zu fahren. Dort besuchten wir mehrere Betriebe, um Wartungsarbeiten an Eindampfanlagen zu erledigen. In der Eindampfanlage von CADBURY in Rathmore (bei Killarney) führten wir Tests durch. Da wir diesmal den Werkstattwagen wieder nach Deutschland zurückbringen sollten, fuhren wir am Sonntag, den 2. Mai 1976, nach Dublin, um mit der Fähre von Dun Laoghaire nach Holyhead in Großbritannien zu gelangen. Dort ein Quartier für eine Nacht zu finden, war ein sehr schwieriges Unterfangen. Wir bekamen ein kleines Zimmerchen unterm Dach und waren glücklich. Zwei Tage waren wir dann noch bei unserem wichtigen, englischen Kunden MMB Maelor in Wrexham (dort hatte ich den Werkstattwagen am 28. Juli 1975 abgeholt). Über Harwich gelangten wir am 5. Mai 1976 zum Hoek van Holland und von dort auf dem schnellsten Wege nach Deutschland. An der deutschen Grenze in Emmerich stieg ich in den Zug nach Karlsruhe ein und Monteur Volkmann fuhr mit dem Werkstattwagen weiter zu unserem Fertigungsbetrieb, Gebr. Becker in Beckum (dorthin gehörte das Fahrzeug).
Dazwischen lagen zahlreiche Reisen quer durch Irland und Nord-Irland, die alle nach dem bereits beschriebenen Muster abliefen und in erster Linie dem Kundenkontakt und der Vorbereitung von Verkaufsverhandlungen dienten. Mehrmals hatten wir Gelegenheit in Newpark Hotel in Kilkenny zu übernachten. Das ausgezeichnete Essen des Hotel-Restaurants ist mir immer noch sehr positiv in Erinnerung. Mit der Zeit hatte ich mich für irische Antiquitäten interessiert und nahm auch schon an Versteigerungen teil. So kam ich zu mehreren antiken Wanduhren, zwei illustrativen Petroleum-Lampen, einer "Carriage Clock", einer kupfernen Bettpfanne und zwei Kutscher-Leuchten. Im Rahmen meiner Scheidung 1989 sind diese Schätze leider aus meinem "Blickfeld" verschwunden.
Bei diesen Reisen durch Irland kam auch die Kultur nicht zu kurz. In dem ausgezeichneten Buch von Jill and Leon Uris "IRELAND a terrible beauty" fand ich eben (am 20. Mai 2010) einen Programmhinweis des GATE THEATER in Dublin. Am Donnerstagabend, den 19. Februar 1976, habe ich mit Derek Cornwell das Theaterstück "The Doctor's Dilemma" von Bernard Shaw besucht.
Ende 1976 fand für mich eine Neuorientierung statt, denn eine mehrjährige Tätigkeit bei NIRO ATOMIZER A/S in Kopenhagen stand an. Ursprünglich sollte ich als Koordinations-Ingenieur ab Januar 1977 für meine deutsche Firma WIEGAND GmbH zu der befreundeten Firma NIRO ATOMIZER A/S nach Dänemark versetzt werden. Da die Dänen damals die französische Verdampfer-Firma LAGUILHARRE kauften, wechselte ich erst als Gruppenleiter und später als Technical Manager (in Holland) zu diesem Konzern. Ich war für den gesamten Eindampfanlagenbau zuständig und auch an den Verkaufsverhandlungen der neuen Anlage (Eindampfung und Sprühtrocknung) für WATERFORD Creameries in Dungarvan/Irland beteiligt. In der Zeit vom 31. Januar bis 11. Mai 1979 leitete ich - mit Unterbrechungen - in Dungarvan die Montage und die Inbetriebnahme. Die Fertigung erfolgte bei unserer Schwesterfirma LAGUILHARRE in Paris. Die Anlieferung der großen Teile mit den Trailern war nicht ganz einfach, denn zu diesem Zeitpunkt gab gerade wieder einen Streik in den irischen Häfen.
Als LAGUILHARRE-Spezialist stand mir der französische Monteur, Jean Maurais, zur Verfügung. Er sprach sehr gut Englisch und ich konnte ausgezeichnet mit ihm zusammenarbeiten. Obwohl die Wetterbedingungen zu dieser Jahreszeit sehr unangenehm waren (es war nasskalt) und wir teilweise im Matsch arbeiten mussten, entwickelte sich die Kooperation mit den Mitarbeitern unseres Kunden Waterford Creameries in Dungarvan sehr positiv.
Insbesondere mit dem irischen Projektleiter, Jim O'Connor, ergab sich eine Freundschaft, die auch nach meinem Ausscheiden bei NIRO ATOMIZER A/S weiter bestand. Im Rahmen unserer Irland-Ferienreise im Jahre 2000 war ich mit ihm mehrmals in telefonischem Kontakt - leider klappte es nicht mit dem beabsichtigten Treffen.
Von meinem ehemaligen Chef bei Niro Atomizer Holland, Adriaan den Hollander, erfuhr ich im vergangenen Jahr, dass in zahlreichen irischen Betrieben meine Pumpen-Innovation "Kavitationsregelung" installiert wurde (durch meinen Lizenznehmer F. Stamp KG, Hamburg-Bergedorf). Vielleicht ergibt sich für mich im Rahmen einer Irland-Rundreise die Möglichkeit, diese Betriebe zu besichtigen und mich dabei doch noch Jim O'Connor zu treffen. Das würde mich sehr freuen! Die Montage selbst verlief - neben den Streiks in den Häfen - auch ansonsten nicht problemlos. Ganz am Anfang stürzte ein irischer Gerüstbauer von einem Träger in die Tiefe und verletzte sich tödlich. Für einen Tag ruhte die Arbeit auf der Baustelle. Da wir unter Termindruck standen, mußte auch am Sonntag gearbeitet werden. Gegen 10 Uhr war plötzlich ein Teil meiner irischen Montage-Mannschaft verschwunden. Nach zwei Stunden kehrten diese reumütig auf die Baustelle zurück. Als ich sie zur Rede stellte, teilten sie mir mit, dass sie die Kirche besuchen mussten.Im Scherz sagte ich darauf: "Am kommenden Sonntag werdet Ihr zur Messezeit angekettet!"
Neben diesen anstrengenden, aber trotzdem entspannten "irischen" Montagebedingungen, hatte ich aber auch Zeit, mich an der eindrucksvollen Südküste umzusehen (mir stand die ganze Zeit einen Mietwagen zur Verfügung, den ich am Flughafen Cork ausgeliehen hatte). Insbesondere das beliebte Seebad von Tramore (in der Nähe von Waterford) hatte mit einem 5 km langen Sandstrand seine besonderen Reize (eine Mischung von Blackpool und Playa de Ingles). Dort fotographierte ich einen auseinandergebrochenen, deutschen Frachter am Strand, den man fast vollständig "ausgeschlachtet" und einige Stahlbleche mit einem Schweißbrenner entfernt hatte. Die "Hauptstadt" des County ist Waterford - weltweit bekannt durch das Kristallglas "Waterford Crystal". Die Fertigung wurde von den Engländern in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch hohe Zölle fast zum Erliegen gebracht. Ab 1947 gelang mit Hilfe von Fachleuten aus Böhmen und Italien wieder ein erfolgreicher Neubeginn.
Auf der Heimfahrt von unserer Irland-Ferienreise erreichten wir am Freitag, den 8. September 2000, gegen 23 Uhr Waterford (wir fuhren gegen 14 Uhr an der Westküste von Connemara in Cleggan los). Eigentlich wollten wir nach einigen Bieren im Auto übernachten. Dann überlegten wir es uns anders und fanden für diese Nacht (von 0 Uhr bis 6 Uhr am Samstagmorgen) doch noch ein "Notquartier". Die hilfsbereite Pub-Betreiberin organisierte dies für uns und zeigte uns den Weg mit ihrem Auto zu der privaten Unterkunft. Am frühen Samstagmorgen fuhren wir von Waterford zum Hafen von Rosslare (in ca. 80 km Entfernung). Gegen 8 Uhr konnten wir auf die Fähre nach Fishguard, mit der wir nach 3,5 Stunden in England (Wales) eintrafen. Vorher suchte ich noch zweimal nach Jim O'Connor, mit dem ich mich verabredet hatte, im Terminal - leider vergeblich! Dies machte mich traurig. Aber vielleicht findet sich in diesem Leben noch einmal die Gelegenheit (Jim müsste in meinem Alter - also 65 - sein)?
Ganz anders war die Küstenlandschaft in der Nähe von Ardmore (20 km westlich von Dungarvan), denn die sehr felsige Küste vermittelte einen ganz anderen, stürmischeren Eindruck. Der Ort Dungarvan selbst (dort hatte ich mein "primitives" Quartier oberhalb von einem Schnell-Imbiss) war ein lebhaftes Städtchen und man lebte in erster Linie von der Fischerei. Es gibt dort die Ruinen eines Normannen-Kastells aus dem 12. Jahrhundert und eines Klosters aus dem 7. Jahrhundert, dessen Gründer, der heilige Garvan, dem Ort seinen Namen verlieh. In der Nähe gelangen mir sehr schöne Aufnahmen des Sonnenuntergangs an der Südküste. In all diesen Fällen war es zum Baden viel kalt. Zum Abschluss der erfolgreichen Montage und Inbetriebnahme gab es eines dieser herrlichen Essen in einem stimmungsvollen, alten Herrenhaus in der Nähe von Dungarvan, zu dem unsere gesamte Mannschaft von Jim O'Connor eingeladen wurde. Es sind diese Freuden, die in Erinnerung geblieben sind. Der Schmutz, der Dreck und die unhygienischen Verhältnisse verloren mit der Zeit ihren Einfluß auf das erfreulich positive Bild von dieser grünen Insel Irland.
Um auch meine Familie an meinem - zugegebenermaßen - idealisierten Irland-Bild teilhaben zu lassen, nahm ich - ausnahmsweise - meine damalige Frau ULLA und meinen neunjährigen Sohn Jochen (er hatte gerade Herbstferien an der Deutschen Schule in Den Haag) mit auf eine Geschäftsreise nach Irland. Wir fuhren bereits am Sonntag, den 19. Oktober 1980, mit meinem Dienstwagen von unserem Wohnort Gouda (Holland) nach Calais in Frankreich und weiter mit der Fähre nach Dover in England. In Guilford (südlich von London) übernachteten wir in einem kleinen, gemütlichen Hotel. Am Montagmorgen ging die Reise weiter zum Fährhafen in Fishguard (Wales). Die letzte Etappe (nach Swansea - denn dort endete der Motorway) über schmale Strassen gestaltete sich sehr spannend, denn wir hatten die Abfahrt mit der Fähre für 16 Uhr reserviert. Es klappte ausgezeichnet und wir konnten in Ruhe das Ablegen der Fähre beobachten.
Gegen 20 Uhr trafen wir am Montagabend, den 20. Oktober 1980, am irischen Fährhafen Rosslare (in der Nähe von Wexford) ein. Nun begann wieder die abenteuerliche Quartiersuche. In der Nähe von Rosslare war nichts zu finden. Da ich mich am Dienstagvormittag, den 21. Oktober 1980, mit Jim O'Connor in seinem Betrieb "Waterford Creameries" in Dungarvan treffen wollte, suchte ich eine Übernachtungsmöglichkeit in der Nähe. In einem romantischen Herrenhaus wurde ich fündig. Beim Wiedersehen mit Jim - nach mehr als 1,5 Jahren - vergaßen wir nicht, uns an die erfolgreiche Zusammenarbeit zu erinnern. Mein "Baby", das ich mit ihm im Mai 1979 in Betrieb genommen hatte, funktionierte einwandfrei.
Wir verabschiedeten uns, ohne zu ahnen, dass wir 20 Jahre später (im Jahre 2000) so grosse Schwierigkeiten haben würden, uns wiederzusehen. Nun konnte ich meiner Familie eine Irland-Tour bieten, die uns vom südlichen Teil fast bis zur Grenze nach Nord-Irland führte. Ich mußte nach Ballghaderreen (Route N 5) im County Roscommon fahren, denn dort war für Donnerstagmorgen, den 23. Oktober 1980, eine Treffen mit meinem langjährigen Kunden, Mr. Cassidy, von der Shannonside Milk Products Cooperative Ltd. vorgesehen. Wir konnten uns unsere Zeit am Dienstag und Mittwoch für die Fahrt in Richtung Norden gemütlich einteilen. Leider spielte das typisch irische Wetter nicht mit und es regnete fast fortlaufend. Meine Frau war von Irland erst einmal enttäuscht. Jochen nahm's lockerer!
Nach der informativen Besprechung fuhren wir am Donnerstag über die N 4 direkt nach Dublin, denn dort wollte ich mich am Freitagmorgen, den 24. Oktober 1980, mit Mitarbeitern der Firma Consolidated Pumps (dem Vertreter meines späteren Lizenznehmers F. Stamp KG) am Flughafen treffen. Die Stimmung meiner Frau verbesserte sich, da wir im Dubliner Gresham Hotel (es zählt zur Spitze in Irland) übernachten konnten. Alleine die Damenkränzchen beim Fünf-Uhr-Tee in der Lounge zu beobachten, war eine besonderer Genuß. Meine Frau blieb während meinem Kundenkontakt im Hotel. Nach dem Auschecken fuhren wir direkt zum Fährhafen Dun Laoghaire. Die Überfahrt nach Liverpool war sehr stürmisch und mein Sohn Jochen hat sein Essen im Restaurant der Fähre sofort wieder erbrochen. Dies war uns zwar unangenehm - der Kellner hatte aber ein Einsehen und berechnete nichts für sein Essen.
|
|
Die Suche nach einem Quartier in Liverpool gestaltete sich zu später Stunde (gegen 23 Uhr) als äußerst schwierig. Nach einigen Anläufen fanden wir eine sehr teure Suite (der teuersten Übernachtung meines bisherigen Berufslebens) und waren froh, als wir uns in die Betten fallen lassen konnten.
Das Irland-Abenteuer hatten wir mit gemischten Gefühlen hinter uns gebracht - was ich zu einem gewissen Grade für meine Frau bedauerte. Auf dem bequemen Motorway fuhren wir am Samstag, den 25. Oktober 1980, über Birmingham in die Nähe von London. Wir suchten einen Ort mit einer S-Bahn-Verbindung ins Londoner Zentrum. Ich kann mich an die Stadt nicht mehr genau erinnern - es könnte Luton gewesen sein. Wir fanden dort eine Übernachtungsmöglichkeit und fuhren am Samstagnachmittag mit der Bahn nach London, um die Tower-Bridge und den Tower zu besichtigen. Also hatten meine Fahrgäste auch noch ihre touristischen Attraktionen und wir konnten anschließend über Harwich und Hoek van Holland in der Nacht auf den Sonntag, den 26. Oktober 1980, wieder wohlbehalten in unser Haus in Gouda (Holland) zurückkehren.
Damit waren nach über 6 Jahren interessanter und auch abenteuerlicher Reisen quer durch Irland und Nord-Irland meine irischen Geschäftskontakte beendet. Sehr schnell änderte sich auch meine berufliche Situation, denn im Frühjahr 1982 begann ich als unabhängiger Beratender Ingenieur eine sehr interessante Tätigkeit in der Molkereiwirtschaft im norddeutschen Raum (im März 1984 zog ich mit meiner Familie von Gouda in unser neues Haus in Hildesheim).
Aber meine "Liebe" und Begeisterung für die grüne Insel ging nicht verloren.
Nach schwierigen Zeiten, die aufgrund eines äußerst trickreichen Verhaltens meines weltweiten Lizenznehmers (F. Stamp KG, Hamburg-Bergedorf - Geschäftsführer Wolfgang Stamp) im Jahre 1988 zu meinem wirtschaftlichen Zusammenbruch und meiner nachfolgenden Scheidung führten, lernte ich am 20. Februar 1996 sehr überraschend in der Schuhstrasse in Hildesheim meine zauberhafte, zweite Frau JUTTA (53) kennen und lieben (am 20. Februar 1998 haben wir standesamtlich und am 5. Juni 1999 evangelisch geheiratet). Ihr erzählte ich so begeistert von meiner Zeit in Irland, dass wir für die Zeit vom 22. August bis zum 3. September 1998 eine Irland-Reise planten. In dieser Zeit kam es aber zu meiner überraschenden Entlassung bei der Hildesheimer Firma EUROKERN (Fertigung von Gießerei-Kernen). Dadurch entfiel auch die wirtschaftliche Basis für die Reise (die abgeschlossene Reise-Rücktrittsversicherung zahlte nicht bei Arbeitsplatz-Verlust).
Erst zwei Jahre später - in der Zwischenzeit hatte ich erfolgreich meine Rente beantragt und mit Reisevorträgen begonnen - konnten wir endlich unsere langgeplante Irland-Reise in der Zeit vom Mittwoch, den 30. August 2000, bis zum Sonntag, den 10. September 2000, antreten.
Bereits am Anfang dieses Reiseberichtes habe ich die besonderen Umstände dieses "Wiedersehens nach 20 Jahren!" beschrieben. Wir hätten es uns einfacher machen können, wenn wir nach Cork oder Shannon geflogen wären und uns dort einen Mietwagen ausgeliehen hätten. Oder wir hätten wir auch über England nach Irland (wie 20 Jahre vorher) fahren können. Aber ich wollte auf Nummer sicher gehen und erst in Irland wieder meine Sicherheit mit dem Linksfahren gewinnen.
Reisetipp "1. Fahrversuche in Irland"
In einem Reisetipp für www.holidaycheck.de schrieb ich: Nachdem wir planmäßig am Hafen von Cherbourg angekommen waren, teilte man uns dort mit, daß die Irland-Fähre wegen der Blockade von französischen Fischerbooten nicht auslaufen könne. Da der Streik voraussichtlich erst in zwei bis drei Tagen beendet sei, empfahl man uns nach Brest zu fahren und an Bord der dortigen Irland-Fähre zu gehen. Wir hatten keine andere Wahl! Unterwegs stellte meine Frau noch fest, daß man uns unsere "Bed & Break-Vouchers" in Cherbourg nicht zurückgegeben hatte. Also der blanke Horror! Die Fähre in Brest sollte um 1 Uhr nachts (und nicht um 17 Uhr wie von Cherbourg) ablegen.
Im Hafen von Brest - wo offensichtlich eine größere Party stattfand - konnte uns niemand die Ablegestelle der Irland-Fähre nennen. Nach einem letzten Versuch in einem Bereich außerhalb des offiziellen Hafens fanden wir erleichtert unser Schiff. Über Funk konnte ich die Probleme mit den Vouchers klären. (Hinweis/Insider-Tipp: Kurz vor Beginn der Reise sollte auf jeden Fall die Hafensituation - Streik usw.- geklärt werden). Da die Transferzeit von beiden Häfen nach Irland ca. 17 Stunden beträgt, kam unsere Fähre in Rosslare nicht vormittags, sondern erst um 18 Uhr am Abend an. Unser Ziel in Cleggan/Connemara lag dann noch 8 Stunden entfernt (dies bei Nacht, Linksverkehr und unzureichenden Beschilderungen). Im Nachhinein sind meine Frau und ich immer noch stolz auf diese Abenteuerreise.
Soweit mein Reisetipp! Und dabei fing diese Reise sehr schön an. Jutta hatte am Mittwochvormittag, den 30. August 2000, noch gearbeitet und meine Aufgabe war es, den Wagen zu packen. Gegen 13 Uhr fuhren wir in Hildesheim los. Über Belgien kamen wir ohne Probleme nach Nordfrankreich (Jutta hatte die Fahrtrouten ausgearbeitet und war ein ausgezeichneter Navigator). Bei Cambrai fanden wir ein kleines, gemütliches Hotel in der Industrie-Zone. Erstmals konnte Jutta meine Französisch-Kenntnisse beobachten und war fasziniert.
Am Donnerstag, den 31. August 2000, starteten wir rechtzeitig gegen 8 Uhr, denn wir mußten - an Paris vorbei - unbedingt die Fähre in Cherbourg (Abfahrt 17 Uhr) erreichen. Von einem eventuellen Streik wußten wir natürlich noch nichts. Allerdings ahnten wir bereits Probleme, denn unterwegs sind wir in einen größeren LKW-Stau hineingeraten, der durch einen Streik verursacht wurde. Wir hatten unterwegs noch soviel Zeit, sodass wir bei Saint-Aubin-sur-Mer (nördlich von Caen) den schönen Strand besichtigten und eine kleine Strandwanderung unternahmen.
Und dann die Hiobs-Botschaft im Hafen von Cherbourg: Wegen eines Streiks der Fischer konnte die Irland-Fähre nicht auslaufen (vielleicht in 2 - 3 Tagen?). Man nannte uns als Alternative die Irland-Fähre, die gegen 1 Uhr nachts von Brest auslief. Wie lange die Fahrt mit dem Auto dauern würde, konnte man uns aber nicht sagen. Wir hatten aber keine andere Wahl und ließen uns auf diesen ersten Teil des Irland-Abenteuers ein. Über die zurückgelassenen Vouchers für "Bed and Breakfast" habe ich bereits gesprochen. Über die Kommunikationskanäle der zuständigen Reedereien konnte ich das Problem schließlich auf der Fähre in Brest und bei der Ankunft in Rosslare (Irland) lösen.
Sehr überraschend kamen wir in Brest bereits um 22 Uhr an (also noch 3 Stunden Zeit bis zur Abfahrt!). Im Hafen waren Menschenmassen unterwegs (ein Festival bzw. ein Hafenfest?). Aber keiner konnte uns sagen, wo die Irland-Fähre ablegt. Nach einigem Hin und Her hatte ich gegen 23 Uhr eine Eingebung: Wir fuhren außerhalb des Hafenbereiches und dann entdeckte ich voller Freude an einem weißen Fährschiff den Schriftzug "Irish Ferries"! Und wieder gab es Probleme, denn erst einmal standen wir mit unserem Wagen vor einem verschlossenen Bauzaun. Wir mußten erst weiter in den Terminal-Bereich fahren. Sie können sicher jetzt noch den Stein hören, der uns damals vom Herzen fiel! Und wir hatten gelernt, uns als Team zu bewähren, das auf gemeinsamen Reisen noch die Welt erobern wird (Nilkreuzfahrt in Ägypten - 2003/2004, Radjasthan-Rundreise in Nordindien - 2007, Kenia-Reise - 2009, China-Rundreise 2011).
Über die Reederei in Rosslare informierten wir unseren irischen Vermieter, die Familie in Hughes in Cleggan an der irischen Westküste, dass wir voraussichtlich in 6 Stunden (wir haben am Freitag, den 1. September 2000, um 18 Uhr nach 17 Stunden Reisezeit im Rosslare-Hafen angelegt) eintreffen würden. Später teilte uns Mr. Hughes (der auf uns gewartet hatte), dass er mit 8 Stunden rechnete.
Dass wir überhaupt in der Nacht ankamen, hatte sehr viel mit Glück und auch mit meiner jahrelangen Reise-Erfahrung in Irland zu tun. Allerdings war mir das Gebiet von Connemara, das wir besuchen wollten, völlig unbekannt.
Einige Beispiele von unterwegs sollen das Abenteuer verdeutlichen. Es war wieder ein Regenbogen-Erlebnis, das kurz nach Rosslare für mich eine "magische" Bedeutung hatte (gewissermassen eine irischer Willkommensgruß!). Unterwegs war Jutta auf der Suche nach einem Geld-Automaten. An einer Tankstelle erklärte man ihr, wo das "hole in the wall" zu finden ist. Um etwas zur Ruhe zu kommen, kauften sie in der Nähe den teuersten Rotwein ihres Lebens. Wir waren also vorgewarnt. Ich hielt mich mit meinen DUBLINERS-Kassetten wach. Gegen 1 Uhr am Samstagmorgen stoppte ich den Wagen am Strassenrand, um etwas frische Luft zu schnappen. Ich vergaß die Scheinwerfer auszuschalten. Dadurch fiel ich einer Polizei-Streife auf. Sie hielten auf der gegenüberliegenden Seite mit ihrem Wagen an und erkundigten sich nach meinem Befinden. Ich nutzte die Gelegenheit, sie nach dem weiteren Weg nach Clifden bzw. Cleggan zu befragen (der 1. Glücksfall).
|
|
In unserem Zielort Cleggan verließ gerade eine größere Gruppe von angeheiterten Gästen eine Hochzeitsfeier. Sie waren aber noch so nüchtern, dass sie uns den Weg zum abseitsgelegenen Haus der Familie Hughes erklären konnten (der 2. Glücksfall). Nach einigen Stunden Schlaf und einer gewissen Enttäuschung über unser primitives "Bed and Breakfast"- Quartier (ich versuchte Jutta zu trösten: "That's Ireland!") unternahmen wir am Samstag, den 2. September 2000, unsere erste Strandwanderung (am Hausstrand Saleana Beach), die auf einer Wiese endete (der Besitzer musste uns befreien). Zu unserer Überraschung entdeckten wir dort auch einen DOLMEN.
Das Wort DOLMEN stammt aus dem Keltischen und bedeutet Steintisch und stellt eine vorgeschichtliche Grabkammer dar. Es besteht aus Tragsteinen, die in der Erde befestigt sind und den Decksteinen, die wie eine Tischplatte aussehen. Das Grab konnte einen oder mehrere Toten enthalten. Besonders häufig kommen DOLMEN in Irland vor. (Reisetipp "Dolmen")
Am Sonntag, den 3. September 2000, unternahmen wir den ersten PKW-Ausflug zum Kylemore Castle (15 km in östlicher Richtung, an der N 59 gelegen). Mitchell Henry war der Erbauer von Kylemore Castle und wurde 1826 in Manchester geboren. Er heiratete 1850 Margarete Vaughan, die Tochter von George Vaughan aus Quilly, Grafschaft Down, Nord-Irland. Die Kosten für den Bau des Schlosses betrugen 1/4 Million Pfund. Der Beginn der Bauarbeiten war 1864. Die Grundsteinlegung von Kylemore Castle fand am 4.9.1867 statt. Der Einzug erfolgte 1868. 1871 zog Mitchell Henry als Abgeordneter für Galway in das Parlament ein. Die Henrys verbrachten 6 glückliche Jahre in Kylemore Castle. 1874 starb Mrs. Henry während einer Ägyptenreise an Ruhr - sie war 45 Jahre alt. 1903 wurde das Schloß von einem Mr. Zimmermann aus Cincinnati/USA erstanden, der es seiner Tochter, der Herzogin von Manchester schenkte. Das Mädcheninternat mit integrierter Tagesschule wurde 1665 in Ypern gegründet und seit 1920 in Kylemore weitergeführt. Kylemore wurde für etwas mehr als 45.000 Pfund von der Ordensgemeinschaft gekauft. 1959 brach im Westflügel der Abtei ein Feuer aus und die Hälfte des Gebäudes wurde zerstört. Heute ist ein Kloster der Benediktinerinnen in Irland. (Reisetipp "Kylemore Abbey")
Auf dem Rückweg verfuhren wir uns zweimal (auch das typisch "Ireland"). Dafür fanden wir auch die sehr schöne Bucht von Renvyle. Selbstverständlich war am Sonntag das einzigste Restaurant in Cleggan geschlossen. Im SPAR-Laden konnten wir uns notdürftig und preiswert versorgen. Am Montag, den 4. September 2000, war ein typischer, irischer Regentag. Allerdings klärte es am Nachmittag auf und wir unternahmen wieder einen schönen Strandspaziergang. Wir fanden auch unser verfallenes Traumhaus! Mrs. Hughes sagte uns, dass es 150.000 Irische Pfund (fast 400.000,- DM) kosten sollte (unglaublich). Diesmal war Oliver's Seafood Bar & Restaurant am Hafen geöffnet. Allerdings war man erst bereit, das Essen um 18 Uhr zu servieren. Ich genoß die "Fisher's Plate", die köstlich schmeckte und Jutta ließ sich "Connemara Lamb" schmecken. Das Guinness (1/2 pint) war genauso scheußlich wie immer und die Rechnung "gesalzen" (23 Irische Pfund entsprechend 60,- DM). Das war auch meine erste Erkenntnis dieser Irland-Reise: Das Leben in Irland ist sehr teuer geworden (verglichen mit meiner Zeit vor 20 bis 25 Jahren).
Am Dienstag, den 5. September 2000, war ein Besuch von Inishbofin-Island geplant. Diese Insel liegt ca. 10 km vor der Küste und ist mit dem täglichen Postboot (für 10 bis 15 Personen und 10 Pfund p.P.) vom Hafen in Cleggan in 30 Minuten sehr leicht zu erreichen (wenn die See nicht gerade sehr stürmisch ist - wie wir es auf der Rückfahrt erlebten). Jutta hatte eine besondere Beziehung zu dieser Insel aufgebaut, denn unser gemeinsamer Traum war damals nach Irland bzw. Inishbofin Island auszuwandern. Vor Ort wollten wir uns einen Eindruck verschaffen. Bei der Einfahrt erkannte man die Ruinen der Cromwell Barracks. Dort war im 17. Jahrhundert das Hauptquartier Cromwell's für Connemara. Während der Zeit von Oliver Cromwell wurden auf der Insel irische Priester, Mönche und Lehrer gefangengehalten. Die ruhige Insel hat traumhafte Strände, weites Grasland und kleinere Seen im Inneren. Im Mai findet das Kunstfestival (mit Musik, Lesungen und Schauspiel) auf der Insel statt. Dann übersteigt die Besucherzahl die Anzahl der 180 Bewohner (vor 100 Jahren gab es noch 900) beträchtlich.
Die Cromwell Barracks standen auf demselben Grund, wo 100 Jahre zuvor BOSCO, ein Pirat und Verbündeter von GRACE O'MALLEY (auch einer Seeräuberin von der Insel Clare Island) ein Schloß errichtet hatte. Noch einige Informationen zu Oliver Cromwell: Er besiegte die aufrührerischen Iren (1. Aufstand am 23. Oktober 1641) und ließ in den Jahren 1649 und 1650 viele Iren ins armselige Connacht (County Galway) vertreiben - frei nach seinem Motto: "Zur Hölle oder nach Connaught!". In Connemara (ein Teil von Connaught) ist heute noch die Hochburg der GAELTACHT, einer Region, in der Gälisch (gleich Irish) gesprochen wird.
|
|
|
|
Vor der katholischen Kirche von Inishbofin Island (diese hat der damalige Pfarrer zur Jahrhundertwende in Eigenleistung mit seiner Kirchengemeinde selbst gebaut) organisierte Jutta eine Sightseeing-Tour mit dem Kleinbus über die gesamte Insel (Fahrpreis 5 Pfund p.P.). Bei relativ schönem, aber kühlem Wetter konnten wir uns so einen sehr guten Eindruck von der Insel verschaffen. Wir fuhren auch an dem verfallenen Kloster St. Colmans Abbey aus dem 7. Jahrhundert vorbei. Gegen 15 Uhr wurde das Wetter schlechter und stürmischer. Sehr interessant war das Treiben an der Pier im "Bofin Harbour". Da am Wochenende ein Festival (einige Touristen waren bereits eingetroffen) stattfinden sollte, mussten die notwendigen Waren vom Postboot ausgeladen und wegtransportiert werden. Eine sehr schöne fotographische Studie der typischen Iren gelang mir bei dieser Gelegenheit. Gegen 17 Uhr ging das Fährboot zurück nach Cleggan. Wegen des sehr schlechten Wetters wurden wir mächtig durchgeschaukelt.
Da wir uns bei unseren Reisen für Kirchen und Friedhöfe interessierten, erkundigten wir uns bei Mrs. Hughes nach der katholischen Kirche, die zur Gemeinde gehörte. Überraschend nannte sie uns den Ort CLADDAGDUFF. Wir kamen auf dem Weg dorthin an verlassenen und verfallenen Cottages vorbei. Die Kirche fanden wir sehr schnell. Nur den Friedhof vermißten wir. Dieser befand sich auf der gegenüberliegenden Insel OMEY ISLAND. Der Weg dorthin war nicht ganz ungefährlich, denn es mußte Ebbe und Flut beachtet werden. Als ich unterwegs ein verlassenes Cottage fotographieren wollte, sah ich in einem verfallenen Wohnwagen das Bein eines schlafenden Menschen. Kurz danach kam der ältere Einsiedler heraus und fragte uns: "Are you Germans?" Als wir dies bejahten, grüsste er mit "Heil Hitler!" Für ihn war wohl der Krieg gegen seine Todfeinde, die Engländer, offensichtlich immer noch nicht vorbei.
|
|
Vor der Kirche von Claggaghduff trafen wir den zuständigen Pfarrer - bereits um 10 Uhr mit einer "Whisky-Fahne"! Da wir den Friedhof nicht fanden, erkundigten wir uns bei ihm. Er wies auf die bereits genannte OMEY Island. Die Gezeiten für Ebbe und Flut konnte er uns nicht nennen, da er erst 14 Tage Pfarrer in dieser Gemeinde sei. Wir wagten es auf gut Glück und kamen trockenen Fußes wieder zurück. Auf dem Rückweg begegnete uns eine einsame Kuhherde, die auf dem Weg zum Friedhof unterwegs war und dort wohl neues Weideland ergründen wollte. (Reisetipp "Inselfriedhof")
Sehr interessant war die "Lobster-Farm" (Hummer) auf dem Rückweg nach Cleggan. Den interessanten Tag beschlossen wir in Oliver's teurem Restaurant am Hafen. Beide aßen wir "Sirloin Steak with French Fried Onions, Chips and Side Salad" - also typisch "Irish". Im weißgestrichenen Pub an der Hafen-Pier mit dem bezeichnenden Namen "Irish Evening" stimmten wir uns vorher mit einigen Pints auf das folgende Abendessen ein.
|
|
|
|
In unserer Sammlung von lokalen Sehenswürdigkeiten fehlte noch die irische Kleinstadt CLIFDEN. Sie hat ca. 1.500 Einwohner (2006) und liegt ca. 80 km von Galway entfernt. Wir benutzten wieder die N 59 (in der entgegengesetzten Richtung kamen wir nach Kylemore Castle). Am letzten Tag vor unserer Abreise, Donnerstag, den 7. September 2000, fuhren wir nach Clifden. Eindrucksvoll waren die beiden Kirchen (für die katholische und die protestantische Gemeinde). Offensichtlich hat sich die protestantische (englische) Gemeinde immer mehr verkleinert, denn von ihr sind nur noch verfallene Grabsteine auf dem protestantischen Friedhof übriggeblieben. Vereinbarungsgemäß kümmerte sich Jutta um das Geldwechseln (irische in englische Pfund) und ich betankte meinen roten CITROEN ZX. Zum Abendessen gab es diesmal die SPAR-Version: Bier und belegte, französische Baguettes). Als Reiselektüre hatte ich "Schindler's List" von Thomas Keneally dabei. Damals ahnte ich noch nicht, dass OSKAR SCHINDLER eine so grosse Bedeutung für mich gewinnen würde (siehe Reisebericht "Argentinien" ). Oskar Schindler hat von 1949 bis 1957 in Argentinien gelebt.
Am Freitag, den 8. September 2000, war der Tag der Abreise. Diese habe ich teilweise im Zusammenhang mit dem Ort "Waterford" an der irischen Südküste bereits beschrieben. Eigentlich wollten an diesem Abend eine "Sing-Song-Veranstaltung" im Pub besuchen (sie wäre leider die einzigste geworden). Dann erst wollten wir fahren. Wir besuchten noch einmal unseren Hausstrand Saleana Beach und wurden dabei richtig nass. Freundlicherweise warf Mrs. Hughes die feuchten Klamotten in den Trockner. Wir hatten nun die "Nase gestrichen voll" und verabschiedeten uns gegen 14 Uhr. Die Frage mit den "Vouchers" war wohl immer noch offen - aber für Mrs. Hughes kein Problem. Die Rückreise verlief ohne größere Schwierigkeiten in einer entspannten Stimmung statt (offensichtlich waren wir beide froh das "irische" Abenteuer glimpflich überstanden zu haben). Die erste Rast war in Galway, wo Jutta mich zum - für uns untypischen - Hamburger mit Pommes Frites und Coca-Cola einlud.
In Ennis nahmen wir uns Zeit für eine kleine Stadtbesichtigung. Das Bunratty Castle bei Limerick blieb uns leider verschlossen, denn dort war eine geschlossene Veranstaltung (nach alter Manier konnte hier gegessen und getrunken werden - begleitet von irischer, traditioneller Musik). Über Limerick (dort hatte ich erstmals vor einem Vierteljahrhundert das Linksfahren erfolgreich geübt) fuhren wir ohne Stopp nach Waterford (über die angenehmen Erfahrungen in Waterford habe ich bereits berichtet).
Auf der Fähre von Rosslare nach Fishguard (Wales), am Samstag, den 9. Oktober 2000, unterhielt ich mich mit Jutta über ein "mysteriöses" Erlebnis: Beide hatten wir auf der Rückfahrt in Irland den Eindruck, dass bei uns ein Kind (ein Schutzengel!) begleiten würde. Und Irland ist ja das Land der Feen und Elfen! Sehr konkret und weniger mystisch waren meine Zahnschmerzen und meine geschwollene Backe (ich behandelte sie mit Schmerztabletten). Die Fahrt quer durch England meisterte ich mit Bravour - Dank der hilfreichen Unterstützung meiner Co-Pilotin Jutta. Insbesondere der Weg auf den mehrspurigen Autobahnen im dichten Verkehr - um London herum - ist mir immer noch lebhaft in Erinnerung. Nachdem wir mit der Fähre von Dover nach Calais wieder das Festland erreicht hatten, hielt uns nichts mehr: am Sonntagmorgen, den 10. September 2000, um 8 Uhr standen wir wohlbehalten und gesund wieder vor unserer heimatlichen Wohnung in Hildesheim.
Nach diesen zahlreichen Reisen nach Irland und Nord-Irland, die sich über einen Zeitraum von 25 Jahren erstrecken, möchte ich gerne Bilanz ziehen. Dabei kann ich nicht verschweigen, dass meine jetzige Frau und Begleiterin bei wunderschönen Reise-Abenteuern, mein idealisiertes Bild sehr stark beeinflusst hat. Sie hat mich gewissermaßen auf den Boden der Tatsachen (was Irland anbelangt) zurückgeführt. Es war vor allen Dingen der Schmutz und auch die unhygienischen Verhältnisse, die uns beide irritiert haben. Nun habe ich ähnliches auf meinen Reisen in Südamerika auch erlebt (siehe Reisebericht "Venezuela" ). Dort sind die Menschen aber immer noch arm. Irland hat man dagegen sehr viele EG-Mittel zur Entwicklung zur Verfügung gestellt. Und was ist dabei herausgekommen? Das Leben ist sehr teuer und die netten Iren sind sehr unfreundlich geworden! Unabhängig davon lasse ich mir aber meine alten Träume nicht nehmen. Meine DUBLINERS und deren "kämpferische" Musik versetzen mich immer noch in eine abenteuerliche Zeit, die ich nicht mehr missen möchte!
Fotos und Text: Klaus Metzger
Siehe auch BILDBAND: (IMPRESSIONEN bei Nacht und in der Dämmerung)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. WEIMAR - eine Kulturstadt!
Weimar ist keine Weltstadt wie Berlin oder München, doch hat diese beschauliche Kleinstadt an der Ilm ihren ganz besonderen Reiz und sogar einen gewissen Weltcharme (UNESCO-Welterbe). Zitiere ich doch gleich zu Beginn die Worte Goethes: „Wo finden Sie auf einem so engen Fleck noch soviel Gutes?“ Zu empfehlen ist ein dreitägiger Aufenthalt in Hotel oder Pension am Rande der Stadt. (Bewertung "Apart Hotel") Dort können Sie dann Ihr Auto stehen lassen und öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Die Thüringer Touristik-Card verschafft Ihnen teilweise vergünstigte Eintrittspreise.
Starten Sie mit einer Stadtrundfahrt, um sich erst einmal einen Eindruck zu verschaffen. Aber es geht auch auf eigene Faust. Weimar ist überschaubar. Wir haben Weimar zu einem Geschichts- und Kulturerlebnis für uns entdeckt und nun begleiten Sie uns auf unserem Rundgang durch die Stadt. Ausgangspunkt ist der Theaterplatz inmitten der Stadt, das Nationaltheater mit dem Denkmal Goethes (1749 bis 1832) und Schillers (1759 bis 1805). Das Wahrzeichen Weimars wurde vom Dresdner Bildhauer Ernst Rietschel 1857 unter den Augen der Weimarer feierlich enthüllt. Den Sockel ziert die Inschrift: „Dem Dichterpaar – Goethe und Schiller – das Vaterland“ Wenn Sie sich umdrehen, schauen Sie auf das Wittumspalais, dem Witwenssitz der Herzogin Anna Amalie, die 1775 – nach Übergabe der Regierungsgeschäfte an Herzog Carl August (1757 bis 1828) – sich dorthin zurückzog.
Noch der Epoche des Rokoko verhaftet, verlieh sie dem neuen Weimar und dem Hofe Glanz und Glorie. Sie gebar ihrem Mann, Herzog Ernst August Konstantin von Sachsen – Weimar zwei Söhne und führte nach dessen Tode ein pflichterfülltes und arbeitsvolles Leben. Kunst, Kultur, Philosophie, Musik – kurz die schönen Künste lagen ihr sehr am Herzen. Die Erzieher beider Söhne waren Christoph Martin Wieland (1733 bis 1813) und Karl Ludwig von Knebel (1744 bis 1834). Im Palais traf sich auch die von Goethe gegründete Freitagsgesellschaft und auch die Freimaurer hatten dort ihre festen Sitzungen. Von dort aus geht es in nördlicher Richtung zum Bauhaus-Museum, der berühmten Designer-Schule des 20. Jahrhunderts. Gehen wir in Richtung Geleitstrasse, zur Scherfgasse, so befinden wir uns vor dem Palais Schardt mit dem Goethe-Pavillon. Bilder "Weimar"
Eine kunstvolle Zeitreise durch das Stadtpalais ist möglich – ergänzt durch Scherenschnitte und eine historische Puppenstubenausstellung. Weiter nördlich befindet sich die Jakobskirche mit dem Jakobsfriedhof. In der Kirche heiratete 1806 Johann Wolfgang von Goethe Christiane Vulpius. Auf dem Friedhof sind – neben Christiane Goethe – auch Caroline Herder und Lucas Cranach der Ältere (1472 bis 1553) beigesetzt. Als nächstes steht als wichtiger Besuchspunkt der Besuch der Stadtkirche St. Peter und Paul, die sogenannte Herderkirche, auf dem Programm. Sie war die Wirkungsstätte von Johann Gottfried Herder (1744 bis 1803) und ist berühmt durch seinen Altar, den Lucas Cranach der Ältere entworfen hat. Lucas Cranach der Jüngere vollendete ihn. Herder ist dort auch beigesetzt. Wir machen einen Abstecher in die Albert – Schweitzer – Gedenkstätte (ehemaliges Haus des Märchendichters Johann Karl August Musäus (1735 bis 1787).
Nun gilt unser Interesse dem Schlossmuseum am Burgplatz (Öffnungszeiten April bis Oktober 10 bis 18 Uhr). Wir interessieren uns für die hochkarätige Europäische Kunstsammlung, beginnend mit der Reformationszeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Endlich erreichen wir auf der Strasse „Am Horn“ und entlang am Park an der Ilm Goethes Gartenhaus. Weiter geht es auf dem Corona – Schröter – Weg zum Römischen Haus. Es ist das erste klassizistische Bauwerk und entstand 1792 bis 1797 als ehemaliger Sommersitz von Herzog Carl August. Wir gehen wieder dem Stadtkern entgegen zur Marienstr. 17, dem sogenannte Liszt – Haus. Es ist die ehemalige Hofgärtnerei und wurde von Franz Liszt (1811 bis 1886), dem berühmten Komponist und Klaviervirtuosen in den Sommermonaten der Jahre 1869 – 1886 bewohnt.
Über die Geschwister-Scholl-Strasse in westlicher Richtung erreichen wir den Historischen Friedhof, die letzte Ruhestätte der Herzoglichen Familie und der Dichtergrößen Goethe und Schiller. Ein Durchbruch verbindet die Fürstengruft mit der angebauten russisch – orthodoxen Kapelle in der Maria Palowna, die Tochter des russischen Zaren Paul I. und Schwiegertochter von Herzog Carl August, ruht. Nun ist es nicht mehr weit bis zum Frauenplan. Das 1709 erbaute Barockhaus mit Hausgarten, in dem der Dichter, Staatsmann und Naturwissenschaftler Johann Wolfgang von Goethe (1749 bis 1832) nahezu 50 Jahre erst als Mieter, dann als Eigentümer bis zu seinem Tode 1832 gelebt hat. Johann Wolfgang von Goethe war durch sein Werk „Die Leiden des jungen Werther“ als „Bestsellerautor“ bekannt geworden. 1774 kam er erstmals nach Weimar und wurde durch Vermittlung von Karl Ludwig von Knebel Herzog Carl August vorgestellt.
1775 folgte er dessen Einladung und zog von Frankfurt am Main nach Weimar. Im Jahre 1776 wurde Goethe von Herzog Carl August geadelt und führte außer seinem Dichterleben u.a. auch das Leben eines Naturwissenschaftlers (Studien über Gartenkultur und die Farbenlehre). Den Dichter verband eine platonische Liebe mit Frau Charlotte von Stein, und erst 1806 heiratete er seinen „Bettschatz“ Christiane Vulpius, mit der er einen überlebenden Sohn August hatte. Alle anderen Kinder verstarben sehr früh. Kennengelernt haben sich beide 1788 im Park an der Ilm, als Christiane Goethe einen Bettelbrief ihres Bruders übergab. Sie führte zeitlebens ein Schattendasein an der Seite dieses großen Mannes. Nun steht noch der Besuch des Schiller-Wohnhauses auf dem Programm. 1802 erwarb Friedrich von Schiller (1759 bis 1805) das spätbarocke Haus. an der Schillerstrasse 12. Er wohnte dort mit seiner Familie, Ehefrau Charlotte und drei Kindern.
Friedrich von Schiller war aufgrund von Schulden und Streitigkeiten mit dem Herzog Karl Eugen heimlich von Stuttgart nach Mannheim geflüchtet. Er verfasste in der Sturm - und Drangzeit Dramen wie „Die Räuber“ und „Kabale und Liebe“. Seine Arbeit als Theaterdirektor in Mannheim war nicht immer von Erfolg gekrönt. Nachdem Schiller 1787 Wieland in Weimar kennengelernt hatte, wirkte er an dessen Zeitschrift mit. Seine erste Begegnung mit Goethe bei den Lengefeldts in Rudolstadt verlief recht kühl. Schiller folgte 1788 einer Professur nach Jena und heiratete 1790 Charlotte von Lengefeldt (1766 bis 1826) und folgte einer Professur nach Jena. Im Laufe der Zeit wurde dem Paar drei Kinder geboren. Wegen seines Gesundheitszustandes musste er seine Professur bereits wieder 1791 aufgeben. Im Jahre 1799 übersiedelte Schiller nach 1802 Weimar und lebte dort nur noch sechs Jahre.
1804 wurde Schiller von Herzog Carl August in den Adelsstand erhoben. 1804 verfasste er sein letztes Werk „Wilhelm Tell) und verstarb nach einer schweren Lungenerkrankung im Jahre 1805. Sein Todesjahr jährt sich heute zum 200ten mal. Wer noch Zeit und Muße hat, dem öffnet sich das Weimar Haus in der Zeit von 10 bis 19 Uhr (April bis September). Das erste mulimediale Erlebnismuseum zeigt eine Zeitreise durch fünf Jahrtausende Weimarer Geschichte. Damit endet unser Kulturwochenende. Vielleicht folgen sie unseren Spuren und wenn Sie noch etwas mehr Zeit haben, so entdecken Sie ja noch das eine oder andere Wichtige, das unseren Augen entgangen ist. Sie können selbstverständlich vor Ort Ihre Geschichtskenntnisse noch vertiefen. Wir wollten Ihnen lediglich einen Anreiz dazu bieten.
Text: Jutta Hartmann-Metzger/Fotos: Klaus Metzger
6. OSTSEE - Entspannung im MIRAMAR in Niendorf/Timmendorfer Strand!
|
|
Timmendorfer Strand
Die wunderschönen Badeorte Timmendorfer Strand und das gemütliche Fischernest Niendorf haben meine Frau, Jutta Hartmann-Metzger , und ich erstmals im August 2005 kennen- und liebengelernt. Wir hatten uns für eine Woche eine Ferienwohnung im Haus der Familie Schneider in Niendorf gemietet. Mit unserem Van Opel Combo Tour konnten wir ohne Schwierigkeiten auch unsere Fahrräder transportieren.
Bei herrlichem Wetter begaben wir uns auf Erkundungsfahrten mit unseren Fahrädern und lernten so die Radwege entlang der Lübecker Bucht kennen. Als wir eines Morgens gemütlich beim Frühstück im Freien vor unserer Ferienwohnung saßen, kam eine Nachbarin mit ihrem Enkelkind auf dem Fahrrad in den Hof gefahren. Sie erkundigte sich, ob uns der Opel Combo Tour gehören würde. Als wir das bejahten, kam die Hiobsbotschaft: Ihre Tochter habe gestern Abend meinen Wagen an der Fahrertür mit ihrem Wagen gestreift.
Nach dem ersten Schreck fand ich es doch sehr erfreulich, dass man den Schaden überhaupt gemeldet hatte. Nach 16 Monaten (wir kauften den Neuwagen im April 2004 beim Autohaus Schünemann in Hildesheim) war dies der erste Unfallschaden und die Abwicklung bei OPEL-Schünemann ging relativ problemlos vonstatten. Die Schadenssumme betrug damals ca. 1.500 Euro.
Am 8. Juni 2011 überraschte uns am Nachmittag unser Nachbar in Hildesheim wieder mit einer Hiobsbotschaft: Er habe beim Einparken (oder seine Frau?) unseren Opel Combo Tour beschädigt . Diesmal waren es zwei sichtbare Beulen - wieder auf der Fahrerseite - aber an der Schiebetour, die nun ausgetauscht werden muss. Der Nachbar verabschiedete sich mit seiner Familie in den Urlaub (Kusadasi/Türkei). Da ich alle Daten hatte, erstellte der Mitarbeiter des Autohauses Schünemann den Kostenvoranschlag (Schadenssumme 2.300,- Euro) mit entsprechenden Fotos und sandte diesen per e-mail an die Kfz-Haftpflicht-Versicherung meines Nachbarn. Ganz anders als im ersten Fall, war es schwierig, die schriftliche Zusage der Kostenübernahme durch die Kfz-Versicherung zu erhalten. Erst als meine Frau sich nach 3 Wochen einschaltete und mit der zuständigen Sachbearbeiterin telefonierte ("von Frau zu Frau") erhielten wir am Donnerstag, den 30. Juni 2011, umgehend die schriftliche "Freigabeerklärung".
|
Meerwasserschwimmbad |
|
|
Als wir am Samstag, den 15. Juli 2006, in Seelze bei Hannover den Geburtstag meines Schwiegervaters feierten, animierte uns das herrliche Sommerwetter anschließend mit unserem Wagen nach Niendorf an die Ostsee zu fahren. Diesmal hatten wir die Campingsachen dabei und wir wollten in unserem umgebauten Van Opel Combo Tour übernachten. Pünktlich zum Abendessen waren wir in Niendorf und genossen die Ankunft mit einer superben Mahlzeit im beliebten Fischrestaurant am Hafen.
Im Supermarkt besorgten wir uns anschließend noch ein passendes Getränk, denn wir wollten den Sonnenuntergang stimmungsvoll am Strand genießen. Als Parkplatz für unser Auto hatten wir in der Nähe des Meerwasserschimmbades eine Abstellmöglichkeit entdeckt. Dies hatte den großen Vorteil, dass wir am nächsten Morgen die Außendusche am Strand benutzen konnten. Nach einem kurzen Bad in den Wellen und noch relativ wenigen Badegästen fuhren wir mit einem sehr zufriedenen Gefühl am Sonntagmorgen, den 16. Juli 2006, wieder nach Hause.
|
SEALIFE am Timmendorfer Strand |
|
|
Unser 3. Besuch von Niendorf/Timmendorfer Strand fand im April 2009 unter sehr viel ungünstigeren Umständen statt. Am 16. Januar 2009 hatte sich meine Frau vor unserer Haustür das linke Bein gebrochen. Die unglaublichen Zusammenhänge habe ich in dem einem Bericht "Hildesheimer Verhältnisse" zusammengefasst. Die Schadenersatz-Verhandlungen zogen sich bis zum Dezember 2009 hin. Im Rahmen des Gütetermines am Landgericht Hildesheim konnte sich meine Frau mit ihren Forderungen eindeutig durchsetzen.
Nach allen Problemen und Schwierigkeiten wollten wir einfach einmal ein Wochenende in Niendorf und am Timmendorfer Strand entspannen. Natürlich war meine Frau durch ihre Krücken immer noch gehandikapt. Aber in Niendorf gelang es ihr erstmals wieder ohne Krücken zu gehen. Von Bekannten hatte Jutta einiges über das SEALIFE am Timmendorfer Strand Reisetipp SEALIFE erfahren. Deshalb besuchten wir diese Attraktion und waren begeistert. Danach begaben wir uns auf die Suche nach einem Quartier. Am Timmendorfer Strand fanden wir nichts passendes. Erst in Niendorf (wo wir uns immer schon hingezogen fühlten) wurden wir fündig. Es war das sehr schöne Strandhotel MIRAMAR, wo wir das Wochenende vom Samstag, den 4. April bis zum Montag, den 6. April 2009, verbrachten. Wir waren so begeistert, dass wir auf jeden Fall wiederkommen wollten: Hotelbewertung "MIRAMAR" April 2009
Diese Gelegenheit ergab sich zwei Jahre später - nach unserer interessanten CHINA-Rundreise im April 2011. Nach unserer Rückkehr habe ich alle chinesischen Hotels und das Yangtse-Kreuzfahrtschiff für www.holidaycheck.de bewertet. Mit meiner Bewertung des Hotels Holiday Inn in North Chongqing Hotelbewertung "Holiday Inn North Chongqing" gewann ich bei holidayCheck einen Reisegutschein über 100,- Euro. Nach einigen Verhandlungen als sehr aktiver User (mit fast 4.000 Punkten) übernahm holidayCheck die Kosten für ein"Traumwochenende" (Samstag, den 4. bis Montag, den 6. Juni 2011) im Strandhotel MIRAMAR. (Fotos "Strandhotel") Wir waren noch begeisterter als vor zwei Jahren: Hotelbewertung "MIRAMAR" Juni 2011
|
Strandhotel MIRAMAR
|
|
|
Seebrücke Niendorf
Es war ein Wochenende mit strahlend blauem Himmel, warmem Wetter und zahlreichen Veranstaltungen in Niendorf. Wir hatten wieder unsere Fahrräder dabei und konnten uns von Niendorf bis zum Timmendorfer Strand frei bewegen. Aber nach unserer anstrengenden Anfahrt von Hildesheim (wegen eines Staus vor Hamburg waren über 5 Stunden unterwegs - normalerweise dauert die Fahrt 2,5 bis 3 Stunden) genossen wir erst einmal die herrliche Aussicht von unserem Balkon auf die See.
Dann lockte uns ein Spaziergang auf dem schönen Strandweg. Ich nutzte die Gelegenheit, barfuß im Wasser zu marschieren, das allerdings noch etwas kalt war. Wir kamen in eine bunte Veranstaltung anlässlich des "Anbadens".
Dies war eine ideale Gelegenheit unsere "geliebten" Bratwürstchen zu probieren. Von der nahegelegenen Seebrücke genossen wir den herrlichen Blick über den Niendorfer Badestrand: Reisetipp "Badestrand"
Mit leckeren Fischbrötchen und kaltem Bier beschlossen wir den ersten Abend in Niendorf auf unserem Balkon und waren immer noch von der herrlichen Aussicht begeistert. Nach einem prächtigen Schlaf freuten wir uns auf das ausgezeichnete Frühstück, für das wir uns bereits vor zwei Jahren begeistern konnten. Danach fuhren wir mit unseren Fahrrädern zum Fischereihafen (Fotos "Fischereihafen"), wo am Sonntag der traditionelle Fischmarkt stattfand: Reisetipp "Fischmarkt am Hafen"
|
Fischereihafen |
|
|
Für den Nachmittag schlug Jutta eine Bootstour vor. Ursprünglich wollten wir mit dem Schiff in den Travemünder Hafen. Diese zweistündige Tour fand aber nicht statt. Dafür begnügten wir uns mit einer einstündigen Küstenfahrt, die auch einen interessanten Eindruck vermittelte: Reisetipp "Bootstour"
Den Abschluß dieses interessanten und erholsamen Wochenendes genoßen wir bei einem Italiener, den wir um die Ecke unseres Hotels entdeckten: Restauranttipp "Da Antonio"
|
Rückkehr von der Bootstour |
|
|
Nach den zahlreichen Fernreisen (Ägypten, Indien, Kenia, China) und den Urlauben in Griechenland und in der Türkei erkannten wir im Rahmen dieses Kurzurlaubes, dass wir in Zukunft die richtige Erholung nur in Niendorf und am Timmendorfer Strand genießen können. Dort finden wir immerwieder viel Vertrautes und die Ehrlichkeit der Einheimischen ist für uns ein wichtiges Kapital. Dazu kommt auch noch der relativ kurze Anreiseweg von Hildesheim.
Text und Fotos: Klaus Metzger
7. Sommer 1959 - Radtour zum BODENSEE und 49 Jahre danach!
|
|

Schloss Laufen am Rheinfall
Es ist schon faszinierend, dass meine Frau, Jutta Hartmann-Metzger, "unbewußt" immerwieder Reiseziele auswählt, wo ich in meiner frühen Jugend schon einmal gewesen bin. So ging es mir kürzlich mit dem Ort Swinemünde (Polen), wo ich als kleines Baby mit meiner Mutter von Bord des Schnellboot-Mutterschiffes "TANGA" auf der dramatischen Flucht aus DANZIG Ende Januar 1945 gegangen bin.
Ich entdeckte kürzlich autobiographische Notizen meines verstorbenen Vaters, der längere Zeit als Exerziermeister für die U-Boot-Bewaffnung in Swinemünde stationiert war. Daraus entstand mein spannender Reisebericht "SWINEMÜNDE - eine Etappe unserer Flucht aus DANZIG". Swinemünde
|
Bernd, Hans, Karl, Klaus (Autor) |
|
|
|
|
Im Oktober 2008 verbrachten wir eine Woche (vom Montag, den 13. Oktober bis Sonntag, den 19. Oktober 2008) am Titisee im Schwarzwald. Auch hier konnte ich auf alten Spuren wandeln, denn ich war im Sommer 1959 zwei Tage (16. August bis 18. August 1959) mit meinen Freunden im Rahmen einer 14-tägigen Radtour auf dem wunderschönen Camping-Platz am Titisee. Die Tour hatte am Samstag, den 15. August 1959, in Brühl bei Mannheim begonnen. Die erste Station war der Camping-Platz von Offenburg. Ursprünglich waren wir fünf Teilnehmer (Karl, Hans, Bernd, Jürgen und Klaus). Aber schon bei der Ankunft in Freiburg (am Sonntag, den 16. August 1959) gab es Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Weiterfahrt in den Schwarzwald. Wir wollten die "Höllentalbahn" (die auch 49 Jahre noch sehr interessant war) benutzen. Bernd und Jürgen nahmen die Strapazen mit ihren Rädern auf sich. Wir trafen uns am Camping-Platz von Titisee wieder. Da es uns dort gefiel, wollten wir zwei Tage bleiben. Bernd und Jürgen drängte es schon am nächsten Tag weiter. Nun bestand unsere Gruppe für den Rest der Tour aus drei Personen und das war gut so.
|
Mein Postsparbuch (1959) |
|
|
In fand in meinem alten, abgelaufenen Postbarbuch interessante Hinweise über Abhebungen auf den verschiedenen Reisestationen. Aber es sind nicht nur die Beträge, sondern auch die Zeitpunkte der Abhebungen von Interesse. So konnte ich nach über 50 Jahren unseren Reiseverlauf zeitlich nachvollziehen. Der Bahnhof von Titisee, der auch heute noch wie damals aussieht, gewann für uns eine besondere Bedeutung. Beim Ausladen der Fahrräder aus dem Zug hatte Karl seine Kamera am Bahnhof vergessen.
Einige Zeit später (nach dem Ende der Reise - ich weiß nicht mehr wann genau) erhielt Karl seine Kamera mit den entwickelten Bildern zurück. Mit der Kamera dürfte folgendes passiert sein: Der Finder hat die Bilder entwickelt und festgestellt, dass wir Radtouristen waren. Deshalb nahm er wohl Kontakt mit dem Camping-Platz in Titisee auf. Dort waren wir aber schon weitergereist. Aber unsere Anschriften lagen ja vor!
|
Karl und Klaus |
|
|
|
|
Dem Camping-Platz galt auch mein erstes Interesse 49 Jahre später (am Dienstag, den 14. Oktober 2008). Ich konnte sogar den Platz am Ufer finden, wo ich mein Dreipersonen-Zelt für uns aufgeschlagen hatte. Die weitere Wanderung mit Jutta um den Titisee war beeindruckend in der herbstlichen Stimmung. Damals genügte uns ein Ausflug mit dem Ruderboot auf den See, um einen guten Überblick zu bekommen. Nach einem leckeren Essen mit einem herrlichen Ausblick über den See begaben wir uns wieder in das Gästehaus Bergseeblick und freuten uns schon auf den Ausflug nach Freiburg am kommenden Tag. Und Jutta erzählte ich Details von unserer Radtour vor 49 Jahren. Bilder "Titisee"
|
Campingplatz Titisee (2008) |
|
|
|
|
Eine besondere Überraschung war für uns im Jahre 2008 die kostenlose Benutzung von Bussen und Bahnen im gesamten Schwarzwald mit unserer KONUS-Gästekarte. Diese erhielten wir bei der Anmeldung in unserem Gästehaus. Das KONUS-Symbol machte die Schwarzwald-Gästekarte zu einem Freifahrausweis. So war die Benutzung der "Höllentalbahn" (in umgekehrter Richtung) schon ein besonders denkwürdiges Ereignis. Vom Freiburger Bahnhof war es nicht sehr weit bis zum Markplatz mit dem Freiburger Münster. Bilder "Freiburg"
|
Stolpersteine in Freiburg |
|
|
Unterwegs sah ich zum erstenmal zwei "Stolpersteine", die an die Judendeportationen im Dritten Reich erinnern sollen. Mich hat das besonders berührt, denn seit über 10 Jahren befasse ich mich als Hobby-Historiker mit dem weltbekannten Judenretter OSKAR SCHINDLER. Dieser hat seine letzten Lebensjahre unter Freunden in meiner Heimatstadt HILDESHEIM verbracht und ist hier am 9. Oktober 1974 im Bernward-Krankenhaus verstorben. Meine Bemühungen um das Ansehen Oskar Schindlers gestalten sich nicht sehr einfach. Aber vielleicht wird demnächst in Hildesheim sogar eine Schule nach ihm benannt. Oskar Schindler
Kurz nach der Rückkehr aus meinem Titisee-Urlaub wurden auch in Hildesheim die ersten "Stolpersteine" gesetzt. Und kürzlich fand eine größere Aktion vor dem hiesigen Goethe-Gymnasium statt. In Erinnerung an 15 Schülerinnen, die von den Nazis umgebracht wurden, plazierte man vor dem Eingang entsprechende "Stolpersteine" (es ist ganz sicher kein Zufall, dass mein Sohn Jochen im Goethe-Gymnasium 1990 sein Abitur gemacht hat). Als ich 1972 in Argentinien lebte und arbeitete, wußte ich nicht, dass Emilie Schindler verarmt in der Nähe (San Vicente) wohnte. Erst mit dem Kofferfund 1999 auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses in der Hildesheimer Göttingstr. 30 wurde ich auf Oskar Schindler aufmerksam. Argentinien
Freiburger Münster
|
|
Während der Radtour 1959 fand die interessante Altstadt mit dem Freiburger Münster, dem Alten Kaufhaus und dem Markplatz nicht unser Interesse, denn wir fuhren sofort mit der "Höllentalbahn" zum Titisee weiter. Ich glaube, dass sich mein Neigung für historische Sehenswürdigkeiten erst später entwickelt hat.
Als ich vor 10 Jahren im Vorruhestand mit meinen Reisevorträgen begann, las ich sehr viel über die weltweit von mir bereisten Länder. Diese Informationen sind auch in meine Reiseberichte eingeflossen.
|
Altes Kaufhaus |
|
|
Nach dem Ausflug nach Freiburg, der sehr eindrucksvoll vor, wählten wir Basel am folgenden Donnerstag, den 16. Oktober 2008, als unser nächstes Reiseziel.
Zuerst benutzten wir den Bus vorm Bahnhof Titisee in Richtung Zell im Wiesental. Den Anstieg oberhalb vom Titisee hatte ich noch von meiner Radtour vor 49 Jahren (am Dienstag, den 18. August 1959) schmerzlich in Erinnerung. In Zell wechselten wir in die bereitstehende S-Bahn nach Basel über.
Verwundert stiegen wir in Basel "Badischer Bahnhof" aus und fragten erstaunt nach dem Weg in die Schweiz. "Sie sind bereits in der Schweiz!" antwortete man uns. Nach einem ausgiebigen Fußmarsch in südlicher Richtung passierten wir zuerst das Messegelände und dann die Rheinbrücke. Nun waren wir uns sicher: "Das ist Basel in der Schweiz!" Der Besuch des Basler Münsters lud zur Meditation ein. Das war uns am Tag vorher im Freiburger Münster nicht vergönnt, denn die Türen waren verschlossen. Bilder "Basel"
Auf dem Rückweg über die Brücke blickte ich in Richtung des Rhein-Oberlaufes, denn dort wollten wir zwei Tage später den "Rheinfall von Schaffhausen" besichtigen. Zur Abwechslung nahmen wir auf dem Heimweg die Route durch das Rheintal nach Freiburg. Die letze Etappe mit der "Höllentalbahn" führte uns wieder nach Hause zum Gästehaus Bergseeblick in Titisee (nach einem Fußmarsch über 400 m).
Rheinbrücke in Basel
|
Am Schluchsee |
|
|
|
|
Am Freitag, den 17. Oktober 2008, wollten wir unbedingt den Schluchsee näher kennenlernen. Mit der Bahn fuhren wir die schöne Strecke vom Bahnhof Titisee zum Bahnhof Schluchsee. Die Nutzung der kostenlosen Transportmöglichkeiten machte uns beiden sehr viel Freude. Unser Opel Combo Tour, mit dem wir angereist waren, blieb die ganze Zeit auf dem Parkplatz vor unserem Gästehaus stehen. Wir waren die einzigsten Spaziergänger auf unserer Wanderung um den Schluchsee. Die Natureindrücke werden wir nie mehr vergessen. Leider hatte Jutta nicht ihre Wanderschuhe angezogen und sie bekam nach und nach Schwierigkeiten mit dem Gehen. Deshalb disponierten wir um und entschlossen uns, zum Feldberg zu fahren. Auf jeden Fall bleibt aber die vollständige Umrundung des Schluchsees auf unserer Liste für den nächsten Schwarzwald-Urlaub. Bilder "Schluchsee"
Am Schluchsee
|
|
Am Bahnhof Aha (oberhalb vom Schluchsee) stiegen wir wieder in die Bahn und fuhren bis zum Bahnhof Feldberg Bärental. Von dort brachte uns der Linienbus zum Feldberg. (Bilder "Feldberg") Mit der Seilbahn ging es auf den Gipfel (1.493 m Höhe).
Wir genossen die herrliche Aussicht und fanden in der Ferne sogar den Titisee. In der Nähe des Feldbergs liegt der kleine Ort Todtnauberg (bei Todtnau). Dort verbrachte ich 1960 eine sehr schöne Freizeit in einem Schullandheim. Wir waren zwei Klassen von der Mittelschule Schwetzingen. Sehr interessante Ausflüge gab es nach Grindelwald (mit einer Übernachtung in der dortigen Jugendherberge) und einen dramatischen Blick auf die Eiger-Nordwand, in der damals ein Toter in der Wand hing. Auch die Hauptstadt Bern stand auf dem Programm.
|
Auf dem Feldberg |
|
|
|
|
Neben der Schweiz besuchten wir auch das Elsaß in Frankreich, das auf der anderen Rheinseite sehr leicht zu erreichen war. Die interessante Stadt Colmar habe ich immer noch in Erinnerung. (Colmar)
Auch hier spielt Jutta jetzt wieder Schicksal, denn sie hat für das 2. Oktoberwochenende einen Kurzausflug nach Colmar geplant und unser dortiges Hotel ist schon seit längerer Zeit gebucht (vielleicht können wir dann auch die offene Umrundung des Schluchsees durchführen).
Aber nun wieder zurück zu unserem Titisee-Urlaub 2008! Dieser Freitag war wirklich ausgefüllt mit Ausflügen in die Natur des Schwarzwaldes.
An unserem letzten Urlaubstag, am Samstag, den 18. Oktober 2008, wandelten wir wieder eindeutig auf alten Spuren, denn wir wollten den Rheinfall von Schaffhausen besichtigen. Dazu mußten wir mit der Bahn einen größeren Umweg zurücklegen. Damals, am Dienstag, den 18. August 1959, radelten wir nach der üblen Steigung am Titisee in Richtung Bonndorf und von dort in die Schweiz nach Schaffhausen. Auf dem Camping-Platz mußte erst einmal geklärt werden, wer einen zusätzlichen Kochtopf besorgen soll (Bernd und Jürgen hatten diesen mitgenommen). Das Los fiel auf Hans. Nach dem Kauf war er sehr verärgert, denn das Preisniveau lag um einiges höher als in Deutschland. Bei der Besichtung erlebten wir erstmals mit dem Rheinfall von Schaffhausen einen größeren Wasserfall aus der Nähe (1972 kamen die Iguazu-Wasserfälle in Südamerika und 1974 die Niagara-Fälle im Winter dazu).
Rheinfall
49 Jahre später mußten wir erst einmal mit Bus und Bahn in Richtung Basel fahren. Dort stiegen wir in den Zug mit Fahrtrichtung Singen um und kamen so bis Schaffhausen. Von dort gab eine kurze Verbindung zum Rheinfall. Auf diesem Umweg waren wir über 5 Stunden unterwegs und mußten einen Differenzbetrag von 25,- Euro zahlen. Es hat sich aber gelohnt, denn der Rheinfall ist in seiner Dramatik unbeschreiblich. Damals waren wir auf der gegenüberliegenden Seite des Rheins. Müde, aber mit dem Eindruck einer wunderschönen Zeit im südlichen Schwarzwald, fuhren wir zurück zum Titisee. Wir sind uns sicher: Wir werden wiederkommen! Bilder "Rheinfall"
Wie ging die Radtour im Sommer 1959 weiter? Am Mittwoch, den 19. August, ging es nach Konstanz am Bodensee. Leider enttäuschte uns der Camping-Platz an der Insel Mainau, denn das Wasser war sehr trübe und schlammig. In meinem Reisebericht "SKANDINAVIEN - von Kopenhagen zum Nordkap!" habe ich auch die Geschichte des Mainau-Besitzers, Graf Bernadotte, erwähnt. Nordkap-Tour
Auf der gegenüberliegenden Seite in Ludwigshafen am Bodensee fühlten wie uns wohler und blieben auf dem dortigen Camping-Platz bis zum Montag, den 24. August 1959. Die nächste Station war Ravensburg mit einem wunderschönen Camping-Platz an einem kleinen Badesee. Fast 20 Jahre später hatte ich beruflich öfters in Ravensburg zu tun, denn wir bauten bei der OMIRA-Molkerei eine neue Eindampfanlage.
In Ulm, wo wir übernachteten, bin ich mir nicht sicher, ob wir das Ulmer Münster besucht haben. Ich glaube, dass wir damals mit unseren Gedanken bereits wieder zu Hause waren. Der Weg nach Stuttgart hatte seine Gemeinheiten. Der Camping-Platz lag in der Nähe des Cannstatter Wasen am Neckar. Auf der vorletzten Etappe nach Neckarsteinach verlor ich meine Sonnenbrille. Es muß an einem der vielen Brunnen gewesen sein, an denen wir uns unterwegs gerne erfrischten. Am Samstag, den 29. August 1959, kamen wir wieder wohlbehalten in unserem Heimatdorf Brühl an. Wir hatten in 14 Tagen eine teilweise sehr strapaziöse Strecke von über 800 Kilometern zurückgelegt. Was ist aus meinen Kameraden geworden? Karl ging ins Bankfach und nahm sich vor längerer Zeit das Leben. Hans wurde Frauenarzt. Leider haben wir uns aus den Augen verloren (kürzliche Such-Recherchen waren erfolglos).
Fotos und Text: Klaus Metzger
Diesen Reisebericht finden Sie auch in meinem Buch:
"Abenteuer meines Lebens (Teil I)" (Reisen meiner Jugend)
|
|
|
|
8. SWINEMÜNDE - eine Etappe unserer Flucht aus DANZIG!
|
|
Mitte Juli 2010 war ich für eine Woche mit meiner Frau, Jutta Hartmann-Metzger, zur Kur in Swinemünde (Polen). Dies war eine sehr große Enttäuschung, die ich in meiner Hotelbewertung deutlich ausgedrückt habe. Villa Herkules
Schloss Sanssouci
Die Reise führte uns mit dem Auto am Freitag, den 16. Juli 2010, über Potsdam, wo wir eine angenehme Übernachtung im "Hotel zum Hofmaler" hatten. Bewertung "Hotel zum Hofmaler"
Gartenanlage Schloss Sanssouci
Am Tag der Ankunft wanderten wir durch das Holländische Viertel (Reisetipp "Holländisches Viertel") zum Schloßpark Sanssouci und waren begeistert. Bilder "Schloss Sanssouci"
Die Weiterfahrt auf der Autobahn nach Stettin, am Samstag, den 17. Juli 2010, gestaltete sich in Polen zu einem Horrortrip. Kurz nach Potsdam fing es an zu regnen und wurde auf der Weiterfahrt immer stärker. Mit der schlechten Autobahn (die Betonplatten waren versetzt) gestaltete sich die Fahrbahn zu tiefen Wassergräben und die Benutzung wurde sehr riskant. Erst mit dem Ende der Autobahn (nach Stettin) verbesserten sich die Strassenverhältnisse und auch der Regen ließ nach. Als wir dann wohlbehalten in der Nähe von Swinemünde ankamen, erlebten wir die nächste Überraschung, denn wir befanden uns auf der Insel Wollin und mußten mit einer "kostenlosen" Fähre nach Swinemünde (auf der Insel Usedom) übersetzen.
|
Die Fähre nach Swinemünde |
|
|
Dort gab es noch einmal ein Verwirrspiel mit den polnischen Strassennamen. Aber mit einem kostenlosen Stadtplan vom örtlichen Tourist-Büro und der ausgezeichneten Orientierungshilfe meiner Frau fanden wir dann doch unser reserviertes Hotel "Villa Herkules".
Sofort parkten wir unser Auto im geschlossenen Bereich hinter dem Hotel (Parkgebühr 7 Euro/Tag) und benutzten es erst mit der Abreise, am Samstag, den 24. Juli 2010, wieder. Die Heimfahrt gestaltete sich sehr viel einfacher, denn wir fuhren bei Ahlbeck (Usedom) über die Grenze und über die Bäderstrasse nach Wolgast (mit der blauen Klappbrücke). Von dort war es nicht weit bis zur Autobahn A20 nach Lübeck.
Ein anderes Interesse, das mit meiner speziellen Biographie zusammenhängt, konnte ich jedoch ganz gut befriedigen. Immer wieder führt mich meine Frau - offensichtlich unbewußt - mit ihren Reiseentscheidungen an Plätze, an denen ich in meiner frühen Jugend schon einmal gewesen bin. Im Oktober 2008 waren wir beispielsweise am Titisee. Dort war ich bereits im Sommer 1959 im Rahmen einer 14-tägigen Radtour mit Freunden über den Schwarzwald zum Rheinfall von Schaffhausen und weiter zum Bodensee. Darüber habe ich kurz in meinem Reisebericht "BORNHOLM - mit dem Fahrrad auf Inseltour!" (Bornholm) geschrieben.
Ursprünglich wollten in Marienbad kuren. Das war aber meiner Frau zu sehr nach dem Zuckerbäcker-Stil und sie entschied sich für eine Kur in Swinemünde (Polen). Es überraschte mich, denn Swinemünde war der Hafen, in dem meine Mutter mit mir auf der Flucht von Danzig Ende Januar 1945 an Land gegangen war.
Da ich autobiographische Reiseberichte schreibe, zählt meine Flucht (im Alter von ca. 8 Wochen) mit meiner Mutter zur dramatischsten und gefährlichsten "Reise" meines Lebens.
Mein ZEIT-Leserartikel "Autobiographische Reiseberichte"
Vor einiger Zeit erinnerte ich mich an eine Kladde, in die mein Vater im Mai 2002 (während seines Krankenhausaufenthaltes in Schwetzingen) autobiograhische Notizen über sein gesamtes Leben geschrieben hat. Meine Mutter lag zu diesem Zeitpunkt im Koma in demselben Krankenhaus. Sie ist am Samstag, den 25. Mai 2002, im Alter von 79 Jahren verstorben. Mein Vater verstarb ein halbes Jahr später, am 8. Dezember 2002, im Alter von 81 Jahren.
Am 10. November 2001 hatte ich - während eines Besuches in Brühl - meine Mutter um nähere Informationen über unsere Flucht aus Danzig gebeten. Erstmals erfuhr ich von der "Wilhelm Gustloff". Auf diesem - später versunkenen - Schiff sollten wir Richtung Westen gebracht werden. Zu unserem Glück war aber auf diesem Schiff kein Platz mehr für uns. Etwas später wurden wir mit dem Schnellboot-Begleitschiff "Tanga" aus Gotenhafen abtransportiert. Unterwegs bat meine Mutter den Kapitän, in Swinemünde von Bord gehen zu dürfen, da sie unbedingt meinen Vater treffen wollte, der dort als Exerziermeister für die U-Bootbewaffung stationiert war. Alle anderen Passagiere (Frauen und Kinder) wurden nach Dänemark ins Internierungslager gebracht.
Nach meiner Rückkehr aus dem Kur-Urlaub in Swinemünde nahm ich Kontakt mit meinem jüngeren Bruder Bernd auf, da dieser die Kladde meines Vaters besitzt, und bat um die entsprechenden Auszüge.
Kutschfahrt durch Swinemünde
|
|
Diese habe ich kürzlich erhalten. Nun erst wurde mir klar, warum es mich "intuitiv" nach Swinemünde hingezogen hat und ich meine Frau über die Enttäuschung mit Swinemünde hinwegtröstete: Ich wandelte - nach 67 Jahren - wieder auf den Spuren meines Vaters, meiner Mutter und meinen eigenen (im Kinderwagen). Jetzt verstehe ich, warum wir in Swinemünde eine "Stadtrundfahrt" in der Kutsche unternommen haben und auch hier erst einmal enttäuscht wurden.
Familie Scharper in DANZIG (X)

Hochzeitsfoto meiner Eltern 16. Januar 1943
Mitte 1943 wurde mein Vater von Libau (heutiges Lettland) als Exerziermeister nach Swinemünde versetzt.
Für den Besuch seiner Familie in Danzig-Langfuhr bekam er einen Tag frei und konnte erstmals sein erstes Kind (meine im Dezember 1943 an Lungenentzündung verstorbene Schwester Karin) in den Arm nehmen. Vor der Stationierung in Libau war mein Vater seit 1942 in Neufahrwasser an der Weichsel-Mündung stationiert (siehe Landkarte von 1940). In der Nähe befand sich die Westerplatte. Diese wurde von der deutschen Kriegsmarine am 1. September 1939 beschossen. So begann der schreckliche 2. Weltkrieg, an dessen Ende meine Mutter mit mir ihre Heimat vor der anrückenden russischen Armee verlassen mußte. Mein Vater verbrachte seine Freizeit mit Marine-Freunden öfters in Danzig-Langfuhr und lernte hier meine Mutter kennen. Ihre Familie hieß Scharper und wohnte im St. Michaels Weg 22 in der Nähe der Blindenanstalt im Süden (siehe Kartenausschnitt). Daneben befand sich die Baufirma König, für die mein Opa Felix damals als Platzverwalter arbeitete. Meine Mutter hatte im Kaiser's Kaffee Geschäft in Danzig-Langfuhr gelernt und war dort Verkäuferin. Als mein Vater sie kennenlernte, war sie 19 Jahre alt.
Meine Eltern hatten am 16. Januar 1943 bei bitterster Kälte in Danzig geheiratet. Selbst seine Eltern (meine Großmutter Eva und mein Großvater Jakob) waren die lange Strecke zur Hochzeitsfeier aus Brühl bei Mannheim angereist. Es war deren erste größere Reise.
Mein Vater beschrieb in seinen autobiographischen Notizen eine lustige Begebenheit vorm Standesamt.
Er hatte seine schmucke Marine-Uniform an und dazu neue Schuhe mit einer Ledersohle. Alle warteten auf die Hochzeitskutsche mit Opa Kuschel (der Vater meiner Oma Grete) als Kutscher. In der linken Hand hielt mein Vater das Familienstammbuch und in der rechten Hitlers "Mein Kampf". Plötzlich kam er wegen der glatten Schuhe ins Rutschen und landete auf dem Hinterteil. "Das fängt ja gut an!" schrieb er 60 Jahre später.
Die Ankunft in Swinemünde war auch für ihn erst einmal sehr enttäuschend, denn seine Unterkunft waren einfache Holzhütten, die mitten im Wald lagen - weit weg von Swinemünde. Unsere Kutschfahrt führte uns in die Nähe, als wir das Fort Engelburg und das Westfort besichtigt haben. Denn ich entdeckte im Wald entsprechende Gebäude. Von dort führte uns der Weg zur Strandpromenade und den mondänen Villen aus der Zeit Theodor Fontanes (sein Vater war Apother und betrieb die Adler-Apotheke an der Strandpromenade).
Pension Herkules
Stadtplan von Swinemünde
Meine Mutter besuchte ihn öfters in Swinemünde und war in einer der Pensionen von Swinemünde einquartiert. In unserem Hotel "Villa Herkules" entdeckte ich als Bild an der Wand eine Werbebroschüre des Hotels vor dem Kriege. Damals hieß es "Pensionshaus Herkules", lag an der Friedrichstrasse und besaß auch ein Restaurant mit Namen "Herkules". Ich entdeckte auch einen alten Stadtplan. Damals hieß der Ort "Bad Swinemünde" mit einem Kurhaus und entsprechenden Kuranlagen. Davon gibt es heute nichts mehr! Und deshalb wiederhole ich meine Behauptung: den Kurgästen wird heutzutage in Swinemünde eine Mogelpackung angeboten, die von den Krankenkassen teilweise finanziert wird.
Nun erlauben Sie mir, zu spekulieren! War meine Mutter vielleicht im "Pensionshaus Herkules" einquartiert? Leider kann ich sie nicht mehr fragen. Der Dienst, den mein Vater damals als Exerziermeister bei der U-Boot-Waffe schob, war "zugegebenermaßen" ein sehr ruhiger. Er konnte meiner Mutter - so schrieb er - sogar bei Übungsfahrten auf der Ostsee mitnehmen ("so konnte sie unsere Lage und Sprüche besser verstehen"). Ausgehend von den hohen Verlusten bei der U-Boot-Waffe während des 2. Weltkrieges, hatte er großes Glück.
Nach dem Tod ihrer ersten Tochter Karin besuchte meine Mutter im Februar 1944 wieder meinen Vater in Swinemünde. Sie äußerte einen erneuten Kinderwunsch, der mit mir am 13. November 1944 in Danzig-Langfuhr in Erfüllung ging.
Ich möchte behaupten, dass auch meine Mutter und mir das Glück geneigt war. Das zeigte sich deutlich bei unserer Flucht aus Danzig Ende Januar 1945. Damals waren die Russen bereits bis nach Hinterpommern vorgedrungen und der Landweg war versperrt (Danzig wurde im März 1945 erobert). Die Flucht über Land war nicht mehr möglich. Meine Mutter hoffte mit mir auf eine Möglichkeit, mit dem ehemaligen KfdF-Kreuzfahrtschiff "Wilhelm Gustloff" herauszukommen. Dies klappte nicht. Das schlimme Schicksal mit der torpedierten "Wilhelm Gustloff" zu ertrinken, blieb uns erspart.
Unsere Rettung war das Schnellbootbegleitschiff "Tanga" (ich hatte von meiner Mutter die falsche Bezeichnung "Tanger" verstanden). Der Name stammt von der Hafenstadt Tanga in der ehemaligen deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika (heute Tansania). Das Schiff wurde 1937 auf der AG Neptun-Werft in Rostock für die chinesische Marine gebaut. 1938 wurde es halbfertig von der Kriegsmarine übernommen. Die Indienststellung war am 21. Januar 1939 mit der Zuteilung zur Schnellbootflottille.
Das Boot war 96,32 m lang, 13,63 m breit und hatte eine Tiefe von 4,14 m. Die Wasserverdrängung betrug 2.100 Tonnen. Es war mit zwei MAN-Dieselmotoren mit jeweils 4.100 PS ausgestattet. Mit dem VULCAN-Getriebe erreichte es eine Höchstgeschwindigkeit von 17,5 Knoten. Der Aktionsradius betrug 8.460 Seemeilen bei 9 Knoten und 5.000 Seemeilen mit 15 Knoten. Als Bewaffnung waren zwei 10,5 cm Geschütze, zwei 3,7 cm Flak und eine 2 cm Flak vorhanden. Die Besatzung betrug 225 Mann.
Bis Mai 1942 diente die "Tanga" als Stabsschiff für Admiral Schmundt in Kirkenes/Nordnorwegen. Danach wurde sie dem S-Boot-Schulverband in der Ostsee bis zum Kriegsende zugewiesen. Nach dem Krieg gehörte das Schiff bis zum 3. Dezember 1947 zum Minenräumdienst. In der Folge wurde es von den Amerikanern beschlagnahmt. Am 8. Juni 1948 kaufte das Boot die dänische Marine und rüstete es in Kopenhagen um. Es wurde am 12. Dezember 1951 unter dem Namen AEgir (Kennung A560) als Tender, Befehlsschiff und Schulschiff in Dienst gestellt. Im September 1964 diente es als Flaggschiff der königlich-dänischen Flottille, die anlässlich der Hochzeitsfeierlichkeiten des griechischen Königs Konstantin II. mit der dänischen Prinzessin Anne-Marie nach Griechenland fuhr. Danach war es wieder Schulschiff. Am 10. Januar 1967 wurde es es außer Dienst gestellt, am 20. Juli 1967 verkauft und anschließend abgewrackt.
Das Schiff, das meine Mutter und mich in den rettenden Westen nach Swinemünde brachte, fuhr weiter nach Dänemark und lieferte die übrigen Frauen und Kinder ins Internierungslager ab. Von meiner ersten Frau ULLA weiß ich von einem ähnlichen Schicksal, das sie als 6-jähriges Mädchen mit ihrer Mutter und ihren beiden Schwestern (ihr Vater war vermißt) von Memel über die Ostsee nach Aarhus führte. Dort mußte sie bis 1949 ausharren, bevor sie mit ihrer Familie nach Süddeutschland (in die Nähe von Bühl) kam. Wir lernten uns 1968 in Karlsruhe beim Fastnachtsball in der Schwarzwaldhalle kennen und heirateten am 31. Mai 1969. Im Lager in Aarhus kümmerte sich ein älterer Däne um Ulla und wiederholte dabei immer wieder folgenden Satz: "Smukke pige, jeg elsker dig! ("Hübsches Mädchen, ich mag Dich!"). Damals konnte meine Fau den Satz nicht verstehen. Dies klappte erst 1977 als wir nach Kopenhagen zogen, wo ich über drei Jahre bei der internationalen Ingenieurfirma NIRO ATOMIZER A/S arbeitete. Meine dänischen Kollegen waren begeistert, dass ich schon nach sechs Monaten fließend dänisch sprechen konnte. Siehe auch: Von Kopenhagen zum Nordkap
Wie ging mein Vater mit der Situation um, als er erfuhr, dass die "Wilhelm Gustloff", mit der meine Mutter und ich aus Danzig flüchten wollten, untergegangen war? Am besten und eindrucksvollsten sind seine eigenen autobiographischen Notizen zu diesem Thema:
Von Wally bekam ich die Nachricht, dass sie mit Kind auf die Gustloff kam. Der Russe stand bald vor Danzig. Zig Flüchtlinge trafen am Ufer ein, um mit einem Schiff rauszukommen. Wally kannte ja unser Lager im Wald, wußte aber nicht, was sich hier tat. Jedenfalls besorgte ich in der Stadt ein Zimmer, wo Wally und Klaus (ca. 5 Wochen alt) Unterkunft hatte. Ich besorgte noch Heizmittel und Essen, damit es auch so an nichts fehlte. Wir luden Flüchtlinge aus Zügen vom Osten aus, wo auch manches Kind totgetrampelt oder sonst ums Leben kam. Es wirkte wohl auf mich. Meine Familie kam ja mit der Gustloff raus. Aber dann: die Gustloff war in der Danziger Bucht torpediert worden und Tausende kamen dabei ums Leben. Wir betreuten weiter die Mengen von Flüchtlingen. Nach ein paar Tagen kamen unsere Leute und meinten: "Meine Familie war doch auch auf der Gustloff!" Sie hätten ein paar Gerettete hier ins Lager bekommen. Ich ging hin und sprach mit ihnen. Aber sie konnten mir das Grauen über ihre ertrunkenen Eltern so nicht erzählen. Auch dass viele Menschen mit dem Schiff untergingen. Es war ja nicht viel Hilfe mit Booten da.
Nun hoffte ich, dass ich auch von Wally etwas erfuhr. Von dem vielen Leid und Elend, das wir auch von den vorbeiziehenden Menschen erkannten und sahen. Oft waren auch meine Sorgen vergessen. So ca. 10 Tage nach dem Untergang der Gustloff machte ich mich auf den Weg, um das reservierte Zimmer abzubestellen. Ich lief auf der rechten Seite in Richtung Stadt. Auf der anderen Seite fuhr eine Frau mit Kinderwagen.
Ich machte mir keine Gedanken darüber, was die wohl vorhatte. Ich sah sie nicht an. Aber die fragte mich: "Papa, kennst Du mich nicht?" Wirklich, meine Frau stand mit Kinderwagen vor mir! Na, sagen konnte ich wohl nichts, denn eine Kiste voll Sorgen fiel mir vor die Füsse. Wir gingen zu dem jetzt nötigen Zimmer. Ein Boot-Mutterschiff hatte Frauen und Kinder noch aus Danzig geholt. Alle Gäste sollten nach Dänemark - dort interniert und verpflegt werden. Meine Frau aber konnte den Kapitän so belabern, dass er sie nach Swinemünde brachte und von Bord zu ihrem Mann gehen ließ. Da Swinemünde bald ausgehungert war, mußte meine Frau auf dem zuständigen Amt um Lebensmittelkarten bitten und wegen Wohnzeit fragen. Freudestrahlend erzählte sie mir, sie dürfe 2 Tage bleiben - dann müsse sie aber weiterziehen. Nach zwei Tagen setzte ich sie in einen Zug in Richtung Süddeutschland.
Der weitere Ablauf der Flucht ist schnell erzählt! Nach unserer Abreise wurde mein Vater zur Bewachung eines U-Boot-Bunkers nach Hamburg abkommandiert. Meine Mutter lernte im Zug eine junge Frau aus Hamburg-Barmbek kennen, die Unterkunftsmöglichkeiten für uns hatte. Alleine suchte meine Mutter ihren Mann in Hamburg.
Am dritten Tag fand sie ihn. Sie konnten noch einmal zwei Tage miteinander verbringen. Dann reiste meine Mutter mit mir weiter zu den Eltern meines Vaters, die in Brühl bei Mannheim lebten. Mein Vater kam am 2. Mai 1945 in der Nähe von Lüneburg in englische Gefangenschaft. Das Sammellager lag an der Elbe und er konnte am anderen Ufer russische Soldaten sehen, die dort patrollierten. Anfang September 1945 wurde er aus der Gefangenschaft entlassen. Er hatte sich einen schwarzen Vollbart zugelegt. Als ich ihn erstmals sah, soll ich weinend davongelaufen sein.
Das erste Familienbild aus dem Jahre 1948 zeigt meine Eltern mit den Kindern. Meine Mutter hat meinen Bruder Bernd auf dem Schoß, der am 31. Mai 1947 geboren ist. Ich mache einen "stabilen" Eindruck und scheine körperlich die Strapazen der Flucht gut überstanden zu haben. Nur in der Psyche sind noch Spuren geblieben (Diagnose: vegetative Dystonie). Sechs Jahre später (Sommer 1954) fuhr ich alleine mit dem Zug von Mannheim nach Hannover, um die Ferien bei Tante Margot (der Schwester meiner Mutter) und ihrer Familie zu verbringen. Darüber berichte ich in meinem weiteren Reisebericht (Thema: "Reisen meiner Jugend").
Fotos und Text: Klaus Metzger
Diesen Reisebericht finden Sie auch in meinem Buch:
"Ein Leben voller Abenteuer (Teil I)" (Reisen meiner Jugend)
Nachtrag:
Im Sommer 2018 informierte mich mein Sohn Jochen, der in der Nähe von Berlin lebt, dass er ein fast neues Buch mit dem TItel "Die Gustloff-Katastrophe" von dem Überlebenden Heinz Schön gefunden hätte. Er hat mir das Buch zugesandt und ich habe es - nach einigem Zögern - sehr erschüttert gelesen, da ich einige wichtige Details erfahren habe, die ich noch nicht kannte. Das Leid, das meine Eltern in den 10 Tagen nach dem Gustloff-Untergang am 30. Januar 1945 in Gotenhafen bzw. in Swinemünde widerfahren ist, kann ich aus heutiger Sicht kaum noch nachvollziehen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. FRANKREICH und das mittelalterliche COLMAR im Elsaß!
|
|
Das Unterlinden-Museum in Colmar
Vom Freitag, den 8. Oktober, bis zum Montag, den 11. Oktober 2010, verbrachten wir ein sehr schönes Wochenende in der französischen Stadt Colmar. Und wieder hatte meine Frau, Jutta Hartmann-Metzger, dieses Reiseziel auf "intuitivem" Wege festgelegt - ohne zu wissen, dass ich bereits vor mehr als 50 Jahren in Colmar gewesen bin. Damals besuchte ich die Mittelschule in Schwetzingen und wir verbrachten 1960 eine Schulfreizeit im Landschulheim in Todtnauberg (Schwarzwald).
Von dort unternahmen wir Ausflüge in die Schweiz nach Grindelwald (in der Nähe der Eiger-Nordwand) und nach Bern. Wir übernachteten in der Jugendherberge von Grindelwald. Da Colmar auf der anderen Rheinseite lag, besuchten wir dort im Rahmen eines Tagesausfluges die Ausstellung mit dem "Isenheimer Altar" von Matthias Grünewald. In meiner Erinnerung blieb nur das Bild dieses Altares präsent und ich dachte, wir hätten es in einer Colmarer Kirche besichtigt. Dies stellte sich aber nun als Fehler heraus.
Es ist schon ein Phänomen, dass Jutta immerwieder Reiseziele auswählt, wo ich schon einmal gewesen bin. Ich kann versichern, dass wir vorher nicht darüber gesprochen hatten. Im Oktober 2008 verbrachten wir eine sehr schöne Woche am TITISEE im Schwarzwald und ich habe darüber ausführlich berichtet (siehe meinen Reisebericht "Radtour zum Bodensee" )
Dieses Jahr im Juli waren wir eine Woche in Swinemünde (im heutigen Polen). Wir wollten dort einen Kururlaub verbringen. Dies war aber eine einzige Enttäuschung. Obwohl Jutta auch dieses Reiseziel unabhängig von mir festgelegt hatte, ergaben sich doch in Swinemünde vorzügliche Möglichkeiten, über die Vergangenheit meiner Eltern zu forschen. Denn ich bin Ende Januar 1945 als acht Wochen altes Baby mit meiner Mutter unter äußerst dramatischen Bedingungen über die eiskalte Ostsee mit dem Schiff "Tanga" vor der anrückenden russischen Armee von Danzig nach Swinemünde geflüchtet. Mein Vater war in Swinemünde als Exerziermeister bei der U-Boot-Waffe stationiert und wartete nach dem Untergang der "Wilhelm Gustloff" verzweifelt auf Nachrichten von uns. Nach meiner Rückkehr aus Polen erhielt ich von meinem jüngeren Bruder Bernd sehr interessante autobiographische Notizen meines verstorbenen Vaters über diese Zeit. In einem spannenden Reisebericht "Swinemünde" schrieb ich darüber.
Als ich vor mehr als 50 Jahren erstmals bei Freiburg mit dem Bus über den Rhein nach Frankreich ins Elsaß fuhr, ahnte ich noch nicht, dass für mich einmal die wunderschönen Ferien mit meiner Familie an der Cote d'Azur in Südfrankreich (1974, 1975 und 1976) eine bleibende Erinnerung bilden würden. Aber auch für meine berufliche Karriere wurde Frankreich von großer Bedeutung.
Mit meinen französischen Sprachkenntnissen und meiner Freude an der französischen Lebensart (die meine 2. Frau Jutta mit mir teilt) nehme ich mir das Recht heraus, mich als "frankophil" zu bezeichnen. Dadurch fiel es mir leicht, intensivere Kontakte über einen längeren Zeitraum mit französischen Geschäftsfreunden zu pflegen.

|
La Rochelle |
|
|
In der Zeit vom 10. Mai bis zum 15. Mai 1973 unternahm ich im eigenen Wagen mit meiner ersten Frau Ulla und meinem zweijährigen Sohn Jochen die erste Geschäftsreise nach Frankreich, um den Kooperationspartner GUERIN in der Nähe von La Rochelle an der Atlantikküste zu besuchen. Dafür legten wir die Gesamtstrecke von ca. 1.000 km (Karlsruhe, Straßburg, Nancy, Troyes, Orleans, Tours, Poitiers, La Rochelle) an einem Tag zurück. In meinem Reisebericht "Die USA und die Niagarafälle im Winter!" habe ich einiges über die Zusammenhänge geschrieben. Ein wichtiger Ausschnitt daraus ist nachfolgend "kursiv" dargestellt.

|
La Rochelle |
|
|
Dagegen waren die Reisen zu GUERIN nach Frankreich immer ein Vergnügen. Zum ersten Kontakt (Anfang Mai 1973) bin ich mit meinem Wagen quer durch Frankreich gefahren und habe meine Frau mitgenommen. Wir übernachteten im vornehmen Hotel LES BRISES in La Rochelle. Der Junior-Chef, Denis Guerin (mein Ansprechpartner für die ABCOR-Projekte), lud uns - gemeinsam mit seiner Frau - zu einem opulenten Abendessen (Motto: "Fruits de mer") ein. Die prächtigen Hummern, Austern und anderen Meeresfrüchte sehe mir immer noch vor meinem geistigen Auge. Es entwickelte sich eine Freundschaft, die über die beruflichen Aspekte hinausging. Allerdings haben wir den Kontakt verloren, als ich nicht mehr mit ABCOR-Projekten beschäftigt war. Bei meinen folgenden Geschäftsreisen flog ich zuerst mit dem Flugzeug nach Paris, um dann am Flughafen Orly in ein kleine Maschine umzusteigen, die mich auf sehr wackligem Kurs nach La Rochelle brachte (wie 1976 am Maracaibosee in Venezuela - siehe Reisebericht "Venezuela" ).

Straßburger Münster
Da ich Denis Guerin damals signalisierte, dass ich mit meiner Familie an der Atlantikküste bei La Rochelle gerne einen Sommerurlaub verbringen wollte, stellte er den Kontakt zu einem seiner Mitarbeiter her, der eine Ferienwohnung auf der schönen Insel Ile de Re vor der Küste besaß.
Unsere Essener Freunde Renate und Werner (mit ihrer zweijährigen Tochter Diane) kamen nach Karlsruhe und übernachteten bei uns (wir hatten bis Anfang März 1973 ebenfalls in der Nähe von Essen gewohnt).
Am frühen Morgen des 14. Juli 1973 fuhren wir in zwei Wagen die bereits bekannte Route durch Frankreich nach La Rochelle. Von dort ging es mir der Fähre auf die Insel Ile de Re. Das Wetter war "durchwachsen" und entsprach nicht den "Traumurlauben", die wir später an der Cote d'Azur in Südfrankreich erlebt haben. Sehr gut hat uns allerdings die ausgezeichnete französische Küche gefallen. Am 30. Juli 1973 begaben wir uns auf getrenntem Wege wieder auf die Heimreise, denn unsere Freunde fuhren über Paris direkt zurück nach Essen und wir nahmen den Weg über Straßburg nach Karlsruhe. Da die Fahrt quer durch Frankreich ausgezeichnet klappte, besuchten wir noch das Stadtzentrum von Straßburg mit dem eindrucksvollen Münster.

Auf der Insel Ile de Re
|
|
|
|
|
|
Nach mehreren Flugreisen zu der Firma GUERIN war ich in der Zeit vom 12. November bis zum 17. November 1974 wieder mit meinem Wagen beruflich unterwegs, um in Paris an einer Fachausstellung für Molkereitechnik für meine damalige Firma WIEGAND Karlsruhe GmbH teilzunehmen. Meine erste Frau Ulla begleitete mich wieder. Bei der Ankunft in unserem reservierten Hotel PLM St. Jacques wurden wir durch einen dreisten Diebstahl richtiggehend schockiert. In meinem Reisebericht "Kolumbien" habe ich dies detailliert beschrieben (nachfolgend "kursiv" dargestellt).
Mit einem schlimmen Diebstahl in einem Pariser Hotel hatte ich bereits meine Erfahrungen gemacht! Während meiner 1. Südamerika-Reise 1972 nach Argentinien wurde ich auf den Ausflügen, die ich ins Landesinnere unternahm, nie bestohlen. Dafür erwischte es mich am Dienstag, den 12. November 1974, in Paris. Damals war dort eine Fachausstellung für Molkereitechnik, an der ich als Mitarbeiter meiner Firma WIEGAND GmbH Karlsruhe (Ettlingen) mit mehreren Kollegen auf dem Ausstellungsstand anwesend war (vom 12. bis 17. November 1974). Die Anreise von Karlsruhe nach Paris erfolgte mit meinem PKW AUDI 60.
Auf der Reise begleitete mich meine damalige Frau ULLA und eine Kollegin, die sehr gut französisch sprach und ebenfalls Standdienst hatte. Nach mehr als 5 Stunden Fahrt kamen wir im reservierten Hotel PLM St. Jacques am Boulevard St. Jacques in Paris an (wir erreichten das Hotel über die Stadtautobahn - Ausfahrt "Porte de Orleans").
Die Rezeption befand sich im 1. OG und war über eine Rolltreppe zu erreichen. Ich bat meine Frau, auf das gesamte Gepäck (auch auf meine braune Aktentasche mit Zahlenschloß!) aufzupassen und begab mich zur Rezeption in ca. 5 m Entfernung. Plötzlich rief Ulla: "Klaus, Klaus...". Und dann sah ich, wie ein Dieb mit meiner Aktentasche zur Rolltreppe rannte. Ich hinterher! Draußen wartete ein weißer Peugeot mit einem Fahrer und mit laufendem Motor, in dem der Dieb verschwand. Ich hatte keine Chancen mehr. Und in der Eile konnte ich mir das Kennzeichen nicht merken.
In der gesamten Aufregung stahl man meiner Frau auch noch den Kosmetik-Koffer. Ulla wollte sofort wieder abreisen, da sie schockiert war. Ich beruhigte sie. Am kommenden Morgen gingen wir gemeinsam mit meiner französischsprechenden Kollegin zur Polizei, um eine Anzeige für unsere Versicherung zu erstatten.
Dort teilte man uns mit, dass im Hotel PLM St. Jacques Diebstähle an der Tagesordnung wären. Zwei Tage später erhielt ich meinen aufgebrochenen Aktenkoffer zurück. Man hatte mir Briefe für unser Pariser Büro mitgegeben. Und die Tasche wurde mit diesen Briefen gefunden und bei der Polizei abgegeben. In unserem Büro war man über den Diebstahl informiert.
Den gesamten Schaden ersetzte nach einigem Hin und Her unsere Hausratversicherung in Deutschland. Im Aktenkoffer hatte ich allerdings noch 1.000 DM als Reserve, die verschwunden waren. Diese wurden nicht ersetzt.
Aber der damalige Personalchef meiner Firma zeigte sich kulant und warnte mich nur, beim nächstenmal etwas besser aufzupassen. Ich hatte also auch meine Lektion für meine folgenden Südamerika-Reisen gelernt.
Von den wunderschönen Sommerferien an der Cote D'Azur in den Jahren 1974, 1975 und 1976 habe ich bereits gesprochen.
Die Empfehlung (er kannte die Gegend von Campingferien her) kam von Roland, dem späteren Ehemann meiner Schwester Karin. Mit beiden fuhren wir in zwei Fahrzeugen, am Montag, den 2. September 1974, in Richtung Süden und blieben dort bis zum 20. September 1974. Wieder begann die Reise am frühen Morgen gegen 4 Uhr in Karlsruhe. Dann ging es über Basel in die Schweiz - an Lausanne und Genf vorbei. Über Lyon im Rhonetal fuhren wir auf der Autobahn in Richtung Marseille, Toulon und dann an der Küste entlang bis zu unserem Zielort Le Lavandou (Gesamtstrecke ca. 1.100 km). Über den ADAC hatten wir ein schönes Appartement in Hanglage oberhalb des Hafens reservieren lassen. Wir waren von dem mediterranen Flair und dem milden Klima fasziniert. Ausflüge mit dem Schiff zu den beiden Inseln Ile de Levant (FKK!) und Ile de Port-Gros (beide Inseln wurden hintereinander angelaufen) hinterließen herrliche Eindrücke.
Gegen Ende des Urlaubes standen noch der Besuch von Nizza und der Zwergstaat Monaco auf dem Programm.
| Der Hafen von Ile de Port-Gros |
|
|

Ile de Port-Gros
 Monaco
Monaco
|
|
|
|
Den 2. Mittelmeer-Urlaub im Sommer 1975 verbrachten wir alleine (mit Ulla und Jochen) an der Cote d'Azur (wir kannten uns ja bereits aus). Diesmal war ich aber ganz gut besonders vorbereitet, denn ich hatte im Frühjahr 1975 einen Tauchkurs besucht. Nun wollte ich erstmals im Mittelmeer tauchen Meine überraschenden Erlebnisse habe ich in meinem Reisebericht "Bonaire" beschrieben.
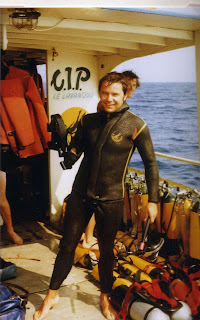
|
1. Tauchgang im Mittelmeer |
|
|

Kathedrale Notre Dame in Paris

|
Kathedrale Notre Dame in Paris |
|
|
|
|
|
|
Bei meinen zahlreichen Reisen nach Frankreich war ich bisher immer nur aus beruflichen Gründen in Paris bzw. bin von dort weitergereist. Ende Mai 1976 wollte ich mit meiner Frau unseren 7. Hochzeitstag feiern. Und dafür erschien uns Paris als die "Stadt der Liebe" am besten geeignet. An anderer Stelle habe ich darüber bereits geschrieben (siehe Reisebericht "Kolumbien" und ich veröffentliche deshalb hier noch einmal den entsprechenden Abschnitt (kursiv).
Zwei Jahre später (vom 28. Mai bis 30. Mai 1976) feierten Jutta und ich unseren 7. Hochzeitstag in Paris und es gab diesmal keine Schwierigkeiten. Ich war von Irland angereist, wo ich mehrere Kunden besucht hatte. Meine Frau kam mit der Bahn zum Gare du Nord in Paris. Wir hatten ein kleines gemütliches Hotel und erwanderten die Sehenswürdigkeiten von Paris zu Fuß. Die Schwierigkeiten kamen 12 Jahre später als mein Lizenznehmer F. Stamp KG in Hamburg-Bergdorf (Geschäftsführer Wolfgang Stamp) mich "kaltlächelnd" ruinierte, indem er vertraglich vereinbarte Mindestlizenzgebühren über 210.000,- DM nicht zahlte und ungerechtfertigte Rückforderungen über 100.000,- DM in Rechnung stellte. Die wirtschaftlichen Probleme führten 1989 zu unserer Scheidung und Ulla zog wieder in ihre alte Heimat nach Karlsruhe. Meine Existenz als selbständiger Beratender Ingenieur und Freier Erfinder war vernichtet. Da der Lizenzvertrag immer noch besteht und mein Geschäftspartner meine Erfindung unter dem Titel "Kavitationsregelung 2000" weltweit vermarktet, werde ich ihn demnächst verklagen (Streitwert 1.000.000,- Euro). Seit 12 Jahren bin ich glücklich mit der 12 Jahre jüngeren Jutta Hartmann-Metzger verheiratet. Sie hat mir entscheidend wieder auf die richtige Spur verholfen.

Eiffelturm
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach diesem romantischen Wochenende endeten "vorübergehend" auch meine Reisen nach Frankreich, denn ich musste mich beruflich als Projektingenieur der Firma WIEGAND Karlsruhe GmbH um die mittel- und südamerikanischen Märkte kümmern. Und dann ergab sich überraschenderweise eine Entwicklung, die ich bereits in meinem Reisebericht "Honduras" beschrieben habe. Den entsprechenden Abschnitt veröffentliche ich an dieser Stelle (nachfolgend "kursiv").
Auf diesem Flug widmete sich der fleißige Vagn ausgiebig seinen Berichten für seine Firma NIRO ATOMIZER A/S in Kopenhagen, während ich mit dem Beobachten und Fotographieren der Landschaft unter uns beschäftigt war. Aber ich konnte mich mit ihm auch ausgiebig über eine sehr interessante Entwicklung unterhalten: Über die "Buschtrommel" hatte ich erfahren, daß für eine neue Stelle eines deutschen Koordinationsingenieurs in seinem dänischen Ingenieurbüro ein Spezialist für Eindampfanlagen meiner befreundeten Firma WIEGAND GmbH Karlsruhe (von dieser bezahlt) gesucht wurde. Nach Angeboten über mehrjährige Tätigkeiten in Australien und Neuseeland, für die ich mich aus privaten Gründen nicht bewarb, fand ich diese Tätigkeit (auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten für meine Familie) sehr attraktiv.
Ich wollte mich deshalb bei meiner Rückkehr nach Deutschland in meiner Firma WIEGAND GmbH Karlsruhe bei meinem damaligen Abteilungsleiter Brand für diesen Posten bewerben. Deshalb befragte ich Vagn auf unserem Flug nach Chile sehr ausführlich über die Lebensbedingungen in Dänemark. Als ich mich nach meiner 3. Südamerika-Reise am Montag, den 20. September 1976, wieder bei Herrn Brand zurückmeldete, fiel er "mit der Tür sofort ins Haus": "Die Dänen wollen Sie haben!" Und genau darüber wollte ich ja mit ihm sprechen. Es waren also meine dänischen Ingenieur-Kollegen (insbesondere Hans Justesen), mit denen ich bereits seit Jahren in der weltweiten Molkereiwirtschaft unterwegs war, die sich für meine "Berufung" eingesetzt haben.
Nach etwas komplizierten Verhandlungen mit meiner deutschen Firma, die insbesondere die Bezahlung anbelangte (meine Frau musste ihre Tätigkeit in Karlsruhe aufgeben) , begann ich am 5. Januar 1977 mit meiner neuen Tätigkeit als Koordinationsingenieur (Fachgebiet: Eindampfanlagen) bei NIRO ATOMIZER A/S in Kopenhagen. Der Umzug von Karlsruhe nach Farum bei Kopenhagen fand in der Zeit vom 1. bis 3. Februar 1977 statt. In einem der ersten Gespräche mit meinen dänischen Kollegen, in der wir die gemeinsame Sprache (Deutsch oder Englisch) festlegten, teilte ich mit, dass ich umgehend Dänisch lernen wolle. Die Dänen waren sehr überrascht und es klappte dann mit der dänischen Sprache überraschend schnell und gut. Es begann eine sehr eindrucksvolle und spannende Zeit (auch für meine erste Frau ULLA und meinen damals 6-jährigen Sohn Jochen), die ich zu einem der schönsten Abschnitte in meinem abwechslungsreichen Leben zählen kann.
Es dauerte nicht sehr lange, da "holte mich Frankreich wieder ein". Als ich mit meiner Familie Ende Juni 1977 mit unserem AUDI 100 eine Abenteuerreise von Kopenhagen zum Nordkap in Norwegen unternahm, ahnte ich noch nichts von den anstehenden Veränderungen in beruflicher und privater Hinsicht (siehe meinen Reisebericht "Skandinavien" ). Im letzten Abschnitt habe ich aber darüber berichtet (kursiv).
Diese Nordkap-Reise unternahm ich unter der Prämisse meines dreijährigen Aufenthaltes als Koordinations-Ingenieurs bei unserer befreundeten dänischen Firma NIRO ATOMIZER A/S in Kopenhagen. Ich war immer noch Mitarbeiter meiner deutschen Firma WIEGAND Karlsruhe GmbH, die auch meinen Aufenthalt in Dänemark finanzierte. Aber diese Bedingungen änderten sich nach meiner Nordkap-Tour sehr schnell, als NIRO ATOMIZER A/S die französische Konkurrenzfirma LAGUILHARRE in Paris kaufte. Nun mußte ich mich mit meiner Familie entscheiden, ob ich als Gruppenleiter (verantwortlich für den Eindampfanlagenbau) zu NIRO ATOMIZER A/S wechseln oder nach etwas mehr als einem halben Jahr wieder nach Deutschland zurückkehren wollte. Wir entschieden uns für Dänemark und meine neue Firma unterstützte mich beim Kauf eines Reihenhauses, das wir im Oktober 1977 in Alleröd (nördlich von Kopenhagen) bezogen. Fünf Jahre später erlebte ich nach einem anderen, sehr interessanten Tauch- und Bade-Urlaub im Jahre 1982 (siehe Reisebericht "Aruba" ähnlich einschneidende, berufliche Veränderungen, denn nach 6 Jahren als Mitarbeiter des dänischen Konzerns NIRO ATOMIZER entschied ich mich für eine neue Herausforderung als unabhängiger Beratender Ingenieur (Wohnsitz und Büro in Hildesheim).
In der Zeit vom 21. bis zum 26. November 1977 flog ich erstmals von Kopenhagen nach Paris, um als verantwortlicher Gruppenleiter unseren neuen Partner für Eindampfanlagen, die Firma LAGUILHARRE und die wichtigsten Mitarbeiter kennenzulernen. Man buchte für mich das angenehme Hotel VERNET, das zentral an der Rue Vernet in der Nähe der Champs Elysees lag. Die Firma LAGUILHARRE befand sich in Nanterre - nicht allzuweit vom Pariser Zentrum entfernt. Aufgrund meiner vorherigen Tätigkeit bei der Konkurrenzfirma WIEGAND Karlsruhe GmbH war LAGUILHARRE keine unbekannte Firma für mich. Zu diesem Thema habe ich weitere Infomationen in meinem Reisebericht "Kolumbien" erwähnt (nachfolgend "kursiv").

|
Champs Elysees bei Nacht |
|
|
Es gab noch ein interessantes Ereignis während dieser Ausstellung in Paris (Parc des Expositions am Porte de Versailles), dessen Bedeutung mir in seiner Tragweite erst vier Jahre später bei meiner neuen Firma NIRO ATOMIZER in Kopenhagen deutlich wurde. Damals kam ich als Koordinations-Ingenieur für meine deutsche Firma nach Dänemark. Nach einem halben Jahr kaufte die dänische Firma NIRO ATOMIZER A/S die französische Verdampferfirma LAGUILHARRE. Damit waren meine Firma WIEGAND GmbH und NIRO ATOMIZER A/S plötzlich Konkurrenten. Ich entschied mich zu NIRO ATOMIZER zu wechseln, wo ich als Gruppenleiter für den Eindampfanlagenbau verantwortlich war. Da ich eine "Konkurrenzklausel" für 2 Jahre hatte, zahlte meine neue Firma 50.000,- DM (!) Ablösung für mich.
Nun reiste ich öfters von Kopenhagen nach Paris, um bei der Firma LAGUILHARRE das Eindampfanlagen-Know-How sicherzustellen und zu verwerten. Das war nicht einfach und gelang mir nur mit einem amerikanischen Kollegen, den ich als Spion in der Firma etabliert hatte. Und dann halfen mir auch meine guten Französischkenntnisse, denn wenn es schwierig wurde, schalteten meine französischen Kollegen von Englisch auf Französisch um. Bei einem meiner ersten Besuche in Paris erfuhr ich von Herrn Laguilharre persönlich, was sich tatsächlich auf der Messe im November 1974 zugetragen hatte. Es ging um die Verletzung eines LAGUILHARRE-Patentes durch meine deutsche Firma.
Deshalb kam LAGUILHARRE mit einem Anwalt auf unseren Ausstellungsstand (das hatte ich am Rande mitbekommen). Da die Patentverletzung eindeutig war, zahlte meine Firma WIEGAND GmbH Karlsruhe später 100.000,- DM an LAGUILHARRE für die Mitbenutzung.
Auf Grund meiner Kontakte mit der französischen Firma GUERIN in den Jahren 1973 bis 1974 hatte ich bereits gute Kenntnisse der französichen Sprache. Allerdings sprach ich mit meinem Geschäftspartner, Denis Guerin (dem Sohn des Inhabers), immer englisch. Bei NIRO ATOMIZER A/S in Kopenhagen bekam ich - neben dem laufenden Dänisch-Unterricht - einen sehr intensiven Französisch-Kurs zur Vorbereitung meiner Geschäftskontakte mit den Mitarbeitern der Firma LAGUILHARRE. Der lustige, belgische Sprachlehrer kam von der BERLITZ School in Kopenhagen und erteilte mir den Sprachunterricht in meiner Firma. Er vermittelte mir auch das Interesse für den belgischen Chansonier JACQUES BREL (einem guten Freund der attraktiven französischen Sängerin JULIETTE GRECO). Ich hörte die Lieder von Jacques Brel gerne, um meine Französischkenntnisse zu verbessern. Mit der Zeit ließ aber meine Begeisterung für ihn nach. Geblieben sind aus der Zeit meiner zahlreichen Reisen nach Irland eigentlich nur noch die DUBLINERS.
Ab 1978 begannen die gemeinsamen Projekte für Eindampfanlagen in Deutschland (z.B. bei OMIRA in Ravensburg) und in Irland, die zahlreiche Reisen erforderten.
Dazwischen lagen immer Koordinationsgespräche bei der Firma LAGUILLHARRE in NanterreFalls es notwendig war, übernachtete ich im bereits genannten Hotel VERNET. Als Beispiel für den sehr flexiblen Ablauf meiner Reisen möchte ich die Erlebnisse in der Zeit vom 17. bis zum 24. Juni 1978 schildern. In Kopenhagen hatte sich damals eine größere Gruppe amerikanischer Kunden angesagt. Für diese hielt ich in englischer Sprache einen Vortrag über mein Fachgebiet "Eindampfanlagen".
Diese Gruppe reiste weiter nach Paris, wo ich wieder als Spezialist für Eindampfanlagen zur Verfügung stehen sollte. Ich flog diesmal nicht mit dem Flugzeug, sondern fuhr mit meinem AUDI 100 von Kopenhagen nach Paris. Unterwegs wollte ich am Wochenende (17./18.) meine Schwester in Trier besuchen. Diese hatte in der Zwischenzeit geheiratet und Roland fand nach dem Studium in Karlsruhe seine erste Anstellung als Diplomingenieur in Trier. Der Besuch war sehr angenehm und am Montag reiste ich weiter nach Paris. Für die Amerikaner hatten die französischen Kollegen meiner Firma NIRO ATOMIZER ein interessantes Programm zusammenstellt.
Dies war alles sehr spannend und abwechslungsreich. Als die Amerikaner am Freitag abgereist waren, verbrachte den Abend mit zwei dänischen Kollegen, die in der amerikanischen Niederlassung arbeiteten. Wir speisten in einem kleinen Restaurant und wurden auf drei hübsche Mädchen aufmerksam.
Später erfuhr ich, dass sich darunter auch eine junge Irin befand, die für IBM in Paris arbeitete. Wir verbrachten gemeinsam einen netten Abend in der Disco des Sheraton Hotels im Pariser Stadtzentrum und es wurde relativ spät.
Am Samstagmorgen musste ich unbedingt wieder nach Deutschland fahren, denn ich hatte abends einen Platz im Autoreisezug von Karlsruhe-Durlach nach Hamburg reserviert. Die Rückfahrt von Paris nach Mannheim war eine Tortur. An jedem 2. Rastplatz musste ich anhalten, um mich etwas auszuruhen. Zu meinem Glück war fast kein Verkehr auf der Autobahn und ich kam wohlbehalten bei meinen Eltern in Brühl bei Mannheim an, wo ich mich erst einmal schlafen legte.
Hier möchte ich etwas einfügen, das mich aus heutiger Sicht sehr dankbar werden lässt: Ich habe meinen Führerschein Klasse 3 am 21. Mai 1964 bekommen. Im Herbst 1964 kauften meine Eltern mir als erstes Auto einen blauen VW mit nichtsynchronisierter Schaltung (damals begann ich mit meinem Studium in Mannheim). Seit dieser Zeit (mit einer Unterbrechung während meiner "Krise" von 1989 bis 1992) habe ich mit wechselnden Fahrzeugtypen eine Gesamtstrecke von über 1.000.000 km zurückgelegt.
Mit Ausnahme von zwei Auffahrunfällen (am 24. Juli 1980 beim Verlassen der Autofähre in Gedser/Dänemark und am 20. September 1993 in Hyeres/Südfrankreich), an denen ich keine Schuld hatte, ist mir nie etwas passiert. Ich sprach damals immer von meinem "Schutzengel". Ein besonderes Elebnis in dieser Hinsicht hatten meine zweite Frau Jutta und ich während unserer Irland-Reise "Irland" im Jahre 2000 (siehe den folgenden Abschnitt "kursiv").
Auf der Fähre von Rosslare nach Fishguard (Wales), am Samstag, den 9. Oktober 2000, unterhielt ich mich mit Jutta über ein "mysteriöses" Erlebnis: Beide hatten wir auf der Rückfahrt in Irland den Eindruck, dass bei uns ein Kind (ein Schutzengel!) begleiten würde. Und Irland ist ja das Land der Feen und Elfen! Sehr konkret und weniger mystisch waren meine Zahnschmerzen und meine geschwollene Backe (ich behandelte sie mit Schmerztabletten). Die Fahrt quer durch England meisterte ich mit Bravour - Dank der hilfreichen Unterstützung meiner Co-Pilotin Jutta. Insbesondere der Weg auf den mehrspurigen Autobahnen im dichten Verkehr - um London herum - ist mir immer noch lebhaft in Erinnerung. Nachdem wir mit der Fähre von Dover nach Calais wieder das Festland erreicht hatten, hielt uns nichts mehr: am Sonntagmorgen, den 10. September 2000, um 8 Uhr standen wir wohlbehalten und gesund wieder vor unserer heimatlichen Wohnung in Hildesheim.
Das Reisen mit dem Autoreisezug war sehr angenehm. Ich habe diese Möglichkeit während meiner Zeit in Dänemark öfters in beiden Richtungen genutzt. Am Samstagabend, den 24. Juni 1978, fuhr der Autoreisezug gegen 23 Uhr in Karlsruhe-Durlach ab und war am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr in Hamburg. Ich hatte also "im Schlaf" eine Strecke von 650 Kilometer zurückgelegt. Die restlichen 350 km nach Hause (Alleroed liegt nördlich von Kopenhagen) fielen mir dann relativ leicht - zumal ich auf der Fähre von Puttgarten nach Roedby wieder eine einstündige Ruhepause hatte.
In der folgenden Woche war ich wieder in Paris - diesmal reiste ich natürlich mit dem Flugzeug. Ich wollte die Molkerei-Fachausstellung, die im vierjährigen Rhythmus in Paris bzw. in Frankfurt stattfand, besuchen. Abends besuchte ich zum Zeitvertreib ein Kino, das an den Champs Elysees lag. An den Titel des Films kann ich mich nicht mehr erinnern. Als ich nach der Vorstellung auf dem Weg zu meinem Hotel VERNET war, wurde ich von einer jungen, hübschen Französin angesprochen. Ich fand das ganz amüsant und schlug ihr vor, zum Tanzen in die mir bereits bekannte DISCO im Sheraton Hotel zu gehen. Sie schlug ein anderes Lokal vor. Als ich dort die dunkle Treppe hinunterging, warnte mich meine innere Stimme (mein Schutzengel?). Ich machte kehrt und eilte alleine in mein Hotel!

Arc de Triomphe
|
|
|
|
Da wir mit einer eigenen Fertigung von Eindampfanlagen in Dänemark begannen, wurden Ende 1978 die Reisen zu unserem französischen Partner LAGUILHARRE immer seltener und endeten 1979 vollständig. Ich war damals intensiv mit dem Aufbau meiner Eindampfanlagen-Abteilung in Kopenhagen beschäftigt.
Aber dann kam wieder ein Karrieresprung mit einschneidenden Veränderungen für meine Familie, denn ich wurde als Technical Manager (verantwortlich für den gesamten Eindampfanlagenbau im NIRO ATOMIZER - Konzern) nach Holland versetzt. Mit meiner Arbeit begann ich im Juni 1980 und meine Familie kam Anfang September 1980 nach. Wir zogen in ein schönes Reihenhaus in Gouda und ich pendelte mit meinem Dienstwagen (AUDI 100) zwischen Utrecht (Ingenieurbüro) und Apeldoorn (Fertigungsbetrieb). Leider gab es in Holland nach einiger Zeit Probleme mit der Organisation, die zu meiner Entscheidung führten, NIRO ATOMIZER zu verlassen. Vorher verlebten wir einen sehr schönen Tauchurlaub auf BONAIRE und genossen den herrlichen Strand von ARUBA (siehe die entsprechenden Ausführungen "kursiv" in meinem Reisebericht "Aruba".
Mit dem Rückflug nach Holland begann für mich auch ein neuer, beruflicher Abschnitt. Da ich mich mit meinen organisatorischen Vorstellungen bei Niro Atomizer in Holland nicht durchsetzen konnte, stellte ich meine Position als Technical Manager zur Verfügung. In Kopenhagen signalisierten mir Freunde (wie Hans Justesen), dass man bei Niro Atomizer A/S in Kopenhagen im Prinzip bereit sei, mir eine Abfindung zu zahlen. Nach einigen "Pokerrunden" mit dem Personalchef meiner Firma konnte ich 35.000,- DM Abfindung und den Erlass meiner Hausfinanzierung (78.000,- Gulden) bei Niro Atomizer A/S durchsetzten.
Mein Gehalt wurde bis Juni 1982 bezahlt und meinen Dienstwagen brauchte ich erst im Juli zurückzugeben. Am 14. Juli 1982 übernahm ich meinen ersten Leasing-Wagen (AUDI 100) von der Firma Schäuble in Oldenburg. Dies waren Ideal-Bedingungen für den Beginn meiner Selbständigkeit als Beratender Ingenieur in der norddeutschen Molkereiwirtschaft (ab Mai 1982) . Im Prinzip hatte ich nur meinen Platz auf die andere Seite des "Verhandlungstisches" (als Berater des Kunden) gewechselt! In März 1984 zogen wir von Gouda in unser neues Haus in Hildesheim um.
Nach meinem Ausscheiden bei NIRO ATOMIZER begann ich sofort mit meiner Tätigkeit als Beratender Ingenieur. So war es für mich naheliegend, wieder nach Frankreich zu reisen, um an meinen alten Kontakten anzuknüpfen. Eine sehr sinnvolle Gelegenheit war die Molkerei-Fachausstellung, die im Juni 1982 wieder in Paris stattfand. Ich fuhr am Mittwoch, den 16. Juni 1982, von Gouda (Holland) nach Frankreich. Nach 5 Stunden unterbrach ich meine Reise und übernachtete in Senlis (40 km nördlich von Paris) in dem preiswerten Hotel Saint-Cloi. Der Ort Senlis gefiel mit dem alten Stadtkern und der gotischen Kathedrale sehr gut, so dass ich dort auch später öfters übernachtete.
Ich traf auf der Ausstellung, am 17. Juni 1982, sehr viele meiner ehemaligen Kollegen von WIEGAND und NIRO ATOMIZER wieder. Besonders freute ich mich über den Kontakt mit Denis Guerin, den ich schon längere Zeit nicht mehr gesehen hatte. Am späten Nachmittag fuhr ich mit einem guten Gefühl wieder nach Hause.
In der Zeit vom 22. bis 24. September 1982 unternahm ich meine 2. Geschäftsreise als unabhängiger Beratender Ingenieur nach Frankreich. Diesmal begleitete mich meine erste Frau Ulla. Wir fuhren zuerst nach Paris, wo ich mehrere Termine hatte. Dann ging es weiter nach Chartres, wo wir im Hotel Grande Monarque übernachteten. Am Donnerstagmorgen, den 23. September 1982, setzten wir die Reise nach Loudeac in der Bretagne fort. Dort traf ich mich mit meinem französischen Beraterkollegen, Monsieur van Opstal. Wir hatten eine Nacht im Hotel de Voyageurs gebucht. Nach meinen alten Notizen in meinem Kalender war dort das Essen gut - aber die Betten schlecht. Am Nachmittag machten wir noch einen Ausflug nach Dinard an der Atlantikküste. Die Rückfahrt am Freitag, den 24. September 1982, von Loudeac nach Gouda nahm fast den ganzen Tag in Anspruch. Das Mittagessen nahmen wir in Senlis ein.
Am 3. Mai bis zum 6. Mai 1983 war ich im Rahmen meiner 3. Geschäftsreise wieder mit meinem Wagen in Frankreich.
Diesmal besuchte ich meinen ehemaligen Kollegen, Gerard Hognon, bei LAGUILHARRE in Nanterre und führte mit ihm ein sehr offenes und informatives Gespräch. Eine ähnliche Erfahrung machte ich auch bei meinen Besuchen bei NIRO ATOMIZER A/S in Kopenhagen mit meinen ehemaligen, dänischen Kollegen. Ich bekam immer sehr nützliche Tipps. Gerard fand für mich auch das kleine Hotel "Forest Hill" in Orsay (ich hatte Probleme mit der Hotelreservierung). Orsay lag südlich von Nanterre.
Ich habe im Hotel-Restaurant wieder ausgezeichnet gegessen. Am Mittwoch, den 4. Mai 1983, hatte ich in Paris ein Gespräch mit einem Mitarbeiter der Firma AMPERE, die mir Gerard Hognon empfohlen hatte. Danach fuhr ich weiter nach Niort, um dort im Hause der Firma GUERIN meinen alten Freund Denis Guerin zu treffen. Ich begrüßte mich auch Monsieur Zwartjes, den ich erstmals am 17. Juni 1982 während der Molkerei-Fachausstellung in Paris kennenlernt hatte (Denis hatte uns gegenseitig vorgestellt). Wieder war es ein sehr offenes und nützliches Gespräch.
Danach fuhr ich mit "Herzklopfen" weiter nach La Rochelle, denn dort war ich vor 10 Jahren erstmals gewesen. Die Einladung von Denis Guerin zu einem opulenten Abendessen (Thema "Fruits de Mer") am Hafen war mir immer noch in Erinnerung. Wir hatten unsere Frauen dabei.
Diesmal genoß ich wieder ein herrliches Dinner am Hafen (allerdings alleine) und dachte an alte Zeiten. Selbstverständlich übernachtete ich auch wieder im Hotel "Les Brises" am Meer. Am 5. Mai 1983 hatte ich ein Gespräch mit einem Prof. Maubois. Leider kann ich mich an die Einzelheiten und den Ort nicht mehr erinnern. Auf der Rückreise besuchte ich am Freitagmorgen noch Herrn Wodetzky von der Deutsch-Französischen Handelskammer in Paris. Er hatte mir Informationen über die Firma COMAP versprochen.
Damals unternahm ich im jährlichen Abstand eine Geschäftsreise nach Frankreich.
Im März 1984 war ich von Gouda/Holland nach Hildesheim in Niedersachsen umgezogen. Meine 4. Geschäftsreise begann am Montag, den 3. September 1984. Ich fuhr über Essen, wo ich unsere Bekannten besuchte. Nach ca. 10 Stunden war ich in Paris. Wieder sprach ich mit Gerard Hognon bei LAGUILHARRE. Am nächsten Tag hatte ich einen Termin bei der Deutsch-Französischen Handelskammer in Paris. Ich benötigte Informationen über die Firma "Le Vide Industriel", die ich am darauffolgenden Freitag besuchte. Am Donnerstag, den 6. September 1984, besichtigte ich die LAITERIE BRIDEL in Laval. Danach ging es wieder nach Paris und von dort nach dem Kundenbesuch wieder heimwärts.
Auf dieser Reise wollte ich die imposante Kathedrale von Chartes, die ich bereits mehrmals aus der Ferne gesehen hatte, näher besichtigen.
Deshalb unterbrach ich meine Fahrt auf der Rückreise nach Paris. Der Bau dieser Kathedrale wurde 1194 begonnen. In der Ile de France entstanden damals die ersten Kirchen im gotischen Stil. Der Architekt hat sich vom massiven Bau der Burgen bei der Errichtung der Kathedrale beinflussen lassen. In dem Bestseller "Die Säulen der Erde" von Ken Follet wird beschrieben, wie zwei Männer sich im England des 12. Jahrhunderts ihren Lebensstraum, nämlich den Bau einer riesigen Kathedrale, erfüllten.

|
Kathedrale von Chartres |
|
|

|
Kathedrale von Chartres |
|
|
Meine 5. und letzte Geschäftsreise fand in der Zeit vom 21. bis zum 24. Mai 1985 statt. Ich fuhr über Karlsruhe nach Paris. In Reuill-Malmaison (dort gibt ein herrliches Schloß) besuchte ich meine ehemaligen Kollegen bei NIRO ATOMIZER France.
Am Donnerstag, den 23. Mai 1985, ging es dann wieder nach Hause. Diese Reise brachte wenig konkrete Ergebnisse und meine Tätigkeiten konzentrierten sich von nun an auf den norddeutschen Raum bzw. meine Geschäfte mit meinem neuen Lizenznehmer F. Stamp KG in Hamburg-Bergedorf.
Im Sommer 1993 (6. bis 26. September) wollte ich meiner damaligen Freundin Iris die herrliche Cote d'Azur (bei Le Lavandou) zeigen und ich hoffte, noch einmal die wunderschöne Ferienzeit vor fast 20 Jahren nacherleben zu können. Dies gelang aus vielerlei Gründen nicht mehr - zumal diese Reise unter einem sehr ungünstigen Stern stand. Iris hatte in Südfrankreich Schlafprobleme. Wir gingen deshalb zum Arzt. Er verschrieb ein Medikament, das wir in der Apotheke mit dem vollen Preis bezahlen mussten. Man teilte uns mit, dass wir uns die Rezeptgebühr in Hyeres (20 km von Le Lavandou entfernt) in der dortigen Verwaltung zurückerstatten lassen könnten. Am Montag, den 20. September 1993, fuhren wir deshalb nach Hyeres. An einer Ampelkreuzung gab es dort gegen 10 Uhr 15 einen furchtbaren Krach, denn ein englisches Wohnmobil konnte bei Rot hinter mir nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Die Polizei kam. Sie wollten den Unfall aber wegen der Beteiligung eines deutschen und eines englischen Fahrers (ein Arzt) nicht protokollieren.
Nach langwierigen Verhandlungen wurde mir von der englischen Versicherung der Zeitwert für meinen FIAT Regata in Höhe von 3.500,- DM erstattet (die Reparatur hätte nach einem deutschen Gutachten 5.600,- DM gekostet). Ich bin mit diesem eingebeulten (aber fahrtüchtigen) Wagen noch bis zum März 1999 gefahren. Dann wurde ich der stolze Besitzer eines roten CITROEN ZX.

|
Unfallschaden in Hyeres |
|
|
Anfang Oktober 2000 passierten wir auf dem Weg nach Irland (wir wollten mit der Fähre von Cherbourg direkt nach Irland gelangen) nach 7 Jahren wieder Frankreich. Diesmal begleitete mich meine zweite Frau JUTTA, die sich auf der gesamten Reise hervorragend als CO-Pilotin bewährte.
So etwas hatte ich auf meinen bisherigen Reisen mit meinen Begleiterinnen noch nicht erlebt. Weitere Informationen zitiere ich aus meinem Reisebericht "Irland" (kursiv).
Aus heutiger Sicht - also nach mehr als 30 Jahren - kann ich diese "Liebe auf den ersten Blick" viel besser erklären, als es mir damals möglich gewesen wäre. Dabei half mir auch unsere langgeplante Irland-Reise (vom 30. August bis zum 10. September 2000) mit meiner 2. Frau JUTTA in die ärmste Gegend Irlands - nach Connemara (westlich von Galway). Es war eine richtige PKW-Rallye mit der irischen Fähre vom französischen Brest (wegen eines Streiks war die Abfahrt von Cherbourg nicht möglich) nach Rosslare in Irland. Und dann mitten in der Nacht (wegen der Verspätung durch den Streik von ca. 8 Stunden) quer durch Irland nach Cleggan (bei Clifden) an der Westküste. Die Rückfahrt gestaltete sich etwas einfacher, in dem wir über Großbritannien wieder nach Hause fuhren. Wir bewährten uns beide als Super-Team (Jutta erhielt von mir anschließend ein Zertifikat "Best Co-Pilot of the World"!). Die detaillierte Geschichte dieses Abenteuer-Urlaubes folgt später!
In einem Reisetipp für www.holidaycheck.de schrieb ich: Nachdem wir planmäßig am Hafen von Cherbourg angekommen waren, teilte man uns dort mit, daß die Irland-Fähre wegen der Blockade von französischen Fischerbooten nicht auslaufen könne Da der Streik voraussichtlich erst in zwei bis drei Tagen beendet sei, empfahl man uns nach Brest zu fahren und an Bord der dortigen Irland-Fähre zu gehen. Wir hatten keine andere Wahl! Unterwegs stellte meine Frau noch fest, daß man uns unsere "Bed & Break-Vouchers" in Cherbourg nicht zurückgegeben hatte.
Also der blanke Horror! Die Fähre in Brest sollte um 1 Uhr nachts (und nicht um 17 Uhr wie von Cherbourg) ablegen Im Hafen von Brest - wo offensichtlich eine größere Party stattfand - konnte uns niemand die Ablegestelle der Irland-Fähre nennen. Nach einem letzten Versuch in einem Bereich außerhalb des offiziellen Hafens fanden wir erleichtert unser Schiff. Über Funk konnte ich die Probleme mit den Vouchers klären. (Hinweis/Insider-Tipp: Kurz vor Beginn der Reise sollte auf jeden Fall die Hafensituation - Streik usw.- geklärt werden). Da die Transferzeit von beiden Häfen nach Irland ca. 17 Stunden beträgt, kam unsere Fähre in Rosslare nicht vormittags, sondern erst um 18 Uhr am Abend an. Unser Ziel in Cleggan/Connemara lag dann noch 8 Stunden entfernt (dies bei Nacht, Linksverkehr und unzureichenden Beschilderungen). Im Nachhinein sind meine Frau und ich immer noch stolz auf diese Abenteuerreise.
Die ausführlichen Beschreibungen meiner zahlreichen beruflich bedingten Reisen und die Ferienreisen nach Frankreich vermitteln ganz sicher einen Eindruck über die starke emotionale Verbindung, die ich zu unserem westlichen Nachbarland, den dortigen Menschen und deren Lebenart immer noch habe. Deshalb freute ich mich sehr auf unsere Wochenendreise nach Colmar - zumal dieses Reiseziel von Jutta wieder einmal "intuitiv" festgelegt wurde. Der "Ausflug" begann gegen 7 Uhr mit unserem OPEL Combo Tour am Freitag, den 8. Oktober 2010 bei herrlichem Wetter in Hildesheim.

Marktplatz von Hildesheim
|
|
|
|
Es gab zwar einige Baustellen unterwegs - trotzdem waren wir nach 8 Stunden relativ frisch und ausgeruht in Colmar (Entfernung 630 km). Schwierig war die Suche nach unserem Hotel Mercure "Champs de Mars" im Stadtzentrum. Die Beschilderung führte uns immerwieder zum 2. Hotel Mercure "Unterlinden". Dort beschrieb man uns den genauen Weg zu unserem gebuchten Hotel. Dieses hat uns sofort gut gefallen (siehe "Hotelbewertung "Mercure Colmar" )
Nach einem ausgiebigen Frühstück gingen wir am Samstagmorgen zu Fuß in das nahegelegene Stadtzentrum. Das interessante Museum Unterlinden mit den "Isenheimer Alter" war unser erstes Ziel (siehe Reisetipp "Museum Unterlinden" )
Das war alles sehr eindrucksvoll. Und ich mußte meine Erinnerung an Colmar korrigieren, den der "Isenheimer Altar" befand sich in einem ehemaligen Kloster, das heutige Museum Unterlinden. Bilder "Museum Unterlinden"

Isenheimer Altar
|
|
|
|
Mit einem detaillierten Stadtplan versehen, wanderten wir danach durch die Altstadt von Colmar und waren von den guterhaltenen, älteren Gebäuden beeindruckt. Jutta teilte mir überraschend mit, dass sie sich hier sehr wohl fühlen würde (die Stadt, die Menschen, die Sprache..). Sie war allerdings schon einmal im Jahre 1974 mit ihrer Abitur-Klasse in der Bretagne und hatte dort den Eindruck, in einem früheren Leben schon einmal hier gewesen zu, da sie vieles wiedererkannte. (Bilder "Wanderung")
Diese Affinität für eine fremde Kultur habe ich in Dänemark erlebt (1977 bis 1980), denn dort ist mir alles sehr leicht gefallen und ich habe mich auch sehr wohl gefüllt. Diese schönsten Eindrücke unserer Wanderung finden Sie in dem Reisetipp "Wanderung durch das Mittelalter"
Sehr interessant war am Sonntag die Wiederbegegnung mit VOLTAIRE im Rahmen der Stadtrundfahrt mit den kleinen, grünen Zug. Wir erfuhren, dass der bekannte französische Schriftsteller und Philosoph (geboren am 21.11.1694 und gestorben am 30.5.1778 in Paris) auch für einige Zeit (Oktober 1753 bis November 1754) in Colmar gelebt hat. Wir waren ihm bereits auf unserer Reise nach Swinemünde (16. bis 24.7.2010) im Schloß Sanssouci in Potsdam begegnet, wo wir durch das Holländische Viertel bis zu den Parkanlagen wanderten. Friedrich der Große hatte Voltaire 1750 nach Potsdam eingeladen. Im Unfrieden verließ dieser aber bereits 1753 wieder den preussischen Hof. Dann ging er wohl nach Colmar. Vielleicht ist Voltaire auch einmal den Weg gegangen, den wir 260 Jahre voller Staunen erwanderten (siehe Reisetipp Reisetipp "Vom Holländischen Viertel..")?
Bei einem Besuch Colmars sollte das Interesse auch dem bekannten Künstler Frederic-August Bartholdi (geboren am 2. August 1834 in Colmar, gestorben am 4. Oktober 1904 in Paris) gelten.
Berühmt ist seine "Freiheitsstatue" in der Hafeneinfahrt in New York, die 1886 eingeweiht wurde. Im Stadtbild Colmars finden sich zahlreiche Werke dieses Meisters (siehe Reisetipp "Der Colmarer Künstler Bartholdi..).
Zum Schluß des Berichtes über unsere Colmar-Reise möchte ich auf ein Thema zu sprechen kommen, das uns Deutschen immer noch sehr unangehm ist: die Zeit der deutschen Besatzung (1940 bis 1945). Die Stadt hatte das große Glück weder zu Beginn noch zum Ende des Krieges bombardiert worden zu sein (sonst wäre die Altstadt nicht so schön erhalten geblieben). Zum ersten Mal bei meinen Reisen nach Frankreich entdeckte ich entsprechende Hinweise (vielleicht hat mich erst die Beschäftigung als Hobbyhistoriker mit dem weltbekannten Judenretter OSKAR SCHINDLER dafür sensibilisiert?). In dem Reisetipp "Spuren der deutschen Besatzung (1940 bis 1945)" habe ich meine Eindrücke zusammengefasst. In der Kathedrale entdeckte ich am Sonntagmorgen (wir besuchten die Heilige Messe um 10 Uhr 30) eine Erinnerungstafel, mit der sich die Kirchengemeinde beim Namenspatron St. Martin für den Beistand während der deutschen Besatzung bedankte! (siehe Reisetipp "Spuren der deutschen Besatzung" ).

Gedenktafel
|
|
|
|
Am Montagmorgen fuhren wir bei wunderschönen Wetter wieder nach Hause. Jutta wollte die Badische Weinstrasse kennenlernen. Deshalb nutzten wir die Bundesstasse 3 von Freiburg nach Offenburg. Dort begaben wir uns wieder auf die Autobahn.
In Brühl bei Mannheim besuchten wir das Grab meiner Eltern, die beide 2002 verstorben sind, und hinterließen in Gedenken ein Grabgesteck. In der Nähe entdeckte ich einen großen Gedenkstein, der an die Toten der Vertreibung erinnerte.
Damit schloß sich der Kreis, der mit dem Besuch in Swinemünde (Polen) im Juli 2010 begann und mit dem ausführlichen Bericht (siehe oben) über unsere dramatische Flucht aus Danzig (Westpreußen) im Januar 1945 endete. Viele meine Verwandten, die nicht rechtzeitig vor den Russen geflüchtet sind, wurden im Sommer 1945 in Viehwaggons nach Barth gebracht, wo sie bei der Ernte helfen mußten, Das ist der Grund, warum ich auch heute noch zahlreiche Verwandte in der Stralsund (das liegt in der Nähe von Barth) habe.
Fotos und Text: Klaus Metzger
10. Das Selketal und die Burg Falkenstein im HARZ
|
|
Burg Falkenstein
Es ist bei uns schon Tradition, den Hochzeitstag (kirchlich am 5. Juni oder standesamtlich am 20. Februar) außerhalb zu feiern. Vergangenes Jahr zog es uns Anfang Juni wieder einmal zum Timmendorfer Strand/Niendorf an der Ostsee. Wir hatten sehr großes Glück mit dem Wetter und verbrachten ein sehr schönes Wochenende in unserem Lieblingshotel MIRAMAR. Als Belohnung für unser Engagement für HolidayCheck (Hotelbewertungen, Reisetipps und Bilder) übernahmen diese die Übernachtungskosten. (Reisebericht "Ostsee")
Dieses Jahr wollten wir eigentlich den standesamtlichen Hochzeitstag im Februar im van der Valk Parkhotel Schloss Meisdorf feiern. Leider war Jutta zu diesem Zeitpunkt so erkältet, dass wir auf unseren zweiten Termin Anfang Juni (Freitag, den 8. bis Sonntag, den 10. Juni 2012) umgebucht haben. Auf dieses ausgezeichnete Hotel sind wir in unserem Gutscheinbuch (Hildesheim und Umgebung) gestoßen. Danach hatten wir ein Essen und eine Übernachtung frei.

van der Valk Parkhotel Schloss Meisdorf
|
|
Die Anfahrt ins 140 Kilometer entfernte Meisdorf am Harz war völlig unproblematisch, da wir fast die gesamte Strecke von Hildesheim auf der sehr gut ausgebauten B 6 fahren konnten. Nur auf der letzten Etappe hinter Quedlinburg mußten wir uns nach dem Weg erkundigen (wir benötigten 1 h 45 min). Das Parkhotel lag etwas versteckt am Ortsausgang von Meisdorf in einem wunderschönen Schlosspark. Wir konnten uns sehr schnell akklimatisieren, indem wir erst einmal ausgiebig zu Mittag assen (es gab Rehbraten mit Knödeln).
Gegen 14 Uhr konnten wir auf unser Zimmer 304 im 3. Stock des "Neuen Schlosses" (dem Gebäudeteil mit dem Turm). Es lag unterm Dach und war sehr geräumig. Dort machten wir "traditionell" erst einmal unsere Siesta. Im Keller unseres Gebäudes befand sich ein Swimming Pool. Die entsprechenden Bademäntel hatten wir uns an der Rezeption besorgt, so dass wir uns gegen 18 Uhr dorthin begeben konnten. Der Ruheraum hatte auch einen Zugang zum Park. Man konnte sich wirklich vorzüglich entspannen. Deshalb bekam unsere Hotelbewertung auch den Titel "Entspannung mit Komfort": Hotelbewertung "Parkhotel"
|
Das Wildgehege |
|
|
Nach einer Stunde (gegen 19 Uhr) wanderten wir durch den herrlichen Park bis zum Wildgehege. Hirsche und ein Mufflon begrüßten uns ohne Scheu (Fotos "Wildgehege") Das Abendessen hatten wir für 20 Uhr reserviert ("Buffet"), sodass wir uns noch in dem eindrucksvollen Schlosspark umsehen konnten (Fotos "Schlosspark") Beim Abendessen waren wir doch sehr überrascht, wieviele Gäste dieses komfortable Parkhotel gebucht hatten (zum Mittagessen waren wir fast alleine und ich fragte im Scherz die Bedienung, ob wir die einzigsten Gäste wären).
|
Im Selketal |
|
|
Am folgenden Samstagmorgen, den 9. Juni 2012, frühstückten wir erst einmal ausgiebig und freuten uns über das sehr schöne Wetter - ideal für die Wanderung durch das Selketal zur Burg Falkenstein (Entfernung ca. 4 km). Gegen 10 Uhr gingen wir los mit Rucksack, Kamera und Getränken. Gegenüber dem Parkhotel fanden wir die erste Orientierungstafel und auch unterwegs gab es zahlreiche Hinweise zur Flora und Fauna im Selketal. (Reisetipp "Selketal und Burg Falkenstein")
Burg Falkenstein vom Selketal
|
|
Zu dieser Zeit waren wir auf unserer Wanderung durch das Selketal nahezu alleine. Dies galt auch auch für den letzten Abschnitt über einen Kilometer, wo es relativ steil bergauf zur Burg Falkenstein ging. Diesen Weg müssen die Esel früher für Transportzwecke benutzt haben, denn er trägt den bezeichnenden Namen "Eselstieg". Wir genossen die Natur und interessierten uns für die zahlreichen Wiesenblumen.(Fotos "Selketal")
 Burg Falkenstein
Burg Falkenstein
|
|
|
|
Nach der sehr entspannten Wanderung durch das Selketal und anstrengenden Aufstieg fanden wir uns auf der Burg Falkenstein mitten in einer größeren Hochzeitsfeier mit dem obligatorischen Fototermin des Brautpaares wieder, der - nach unserem Eindruck - die gesamte Burg beanspruchte. Trotzdem fanden wir einen ruhigen Platz und genossen die herrliche Aussicht. (Fotos "Burg Falkenstein")
|
Burgkapelle |
|
|
Nach einem kleinen Imbiss (Bratwurst) und der Besichtigung der Burg (insbesondere die Burgkapelle war sehr beeindruckend) machten wir uns auf den Heimweg. Diesmal benutzten wir nach dem Abstieg die Landstrasse nach Meisdorf, wo wir gegen 14 Uhr wieder gesund und munter und mit vielen Eindrücken (Bildern) eintrafen.
Europa-Rosarium in Sangerhausen

Rosenpracht
Am Sonntagmorgen, den 10. Juni 2012, war nach dem Frühstück die Heimfahrt geplant. Jutta wünschte sich, unterwegs das Europa-Rosarium in Sangerhausen (Reisetipp "Rosarium") zu besuchen. Dies lag ca. 40 km von Meisdorf entfernt und wir kamen dort pünktlich zur Öffnung gegen 9 Uhr 30 an. Fast zwei Stunden liessen wir uns von der Blütenpracht der zahlreichen Rosen beeindrucken. Jutta erwies sich wieder einmal als Meisterin bei der Aufnahme der besten Fotomotive. (Fotos "Rosarium")

Jutta und Klaus im Europa-Rosarium
Die weitere Strecke hatte Jutta als tüchtige Copilotin (während unserer abenteuerlichen Irland-Reise - Reisebericht "Irland" - im Jahre 2.000 habe ich ihr für ihre Verdienste das Zertifikat "Best Co-pilot of the World" verliehen) die weitere Fahrtroute durch den Harz festgelegt: von Sangerhausen fuhren wir nach Nordhausen, Braunlage, Clausthal-Zellerfeld und über die Autobahn von Seesen nach Hildesheim. Kurz vor 15 Uhr waren wir wieder wohlbehalten zu Hause. Und wieder einmal haben wir unseren Hochzeitstag in einem interessanten Rahmen "zelebriert".
Ich habe auch einen schönen BILDBAND "Selketal und Falkenstein" zusammengestellt.
Fotos und Text: Klaus Metzger
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Eine Kutschfahrt in der Lüneburger Heide
|
|
Nach dem sehr schönen HARZ- Wochenende Anfang Juni 2012 (HARZ-Wochenende) haben wir für den Monat August einen Ausflug in die Lüneburger Heide geplant. Am Samstag, den 18. August 2012, war es soweit.
Allerdings war dies das heißeste Wochenende in diesem Sommer (über 30 grd. C) und wir standen vor der Entscheidung, die geplante Strecke von 10 km (insgesamt also 20 km) zu wandern, die halbe Strecke mit der Kutsche oder die gesamte Strecke von Undeloh bis zum Wilseder Berg (und zurück) als Kutschfahrt zurückzulegen.
Wegen der Hitze wollten wir kein Risiko eingehen und entschieden uns für die komplette Kutschfahrt.(Kutschfahrt) Jutta hatte vorab im Internet recherchiert und herausgefunden, dass der Ferienhof Heins die günstigsten Kutschfahrten anbot. Wir wurden nicht enttäuscht und konnten unsere Zufriedenheit auch weitergeben. (Dankschreiben "Ferienhof Heins") Das nächste Mal werden wir mit unseren Fahrrädern diese Strecke, die wir nun bereits kennen, zurücklegen und uns noch mehr an der Heidelandschaft erfreuen.
Die Kirche von Undeloh
|
|
Da wir von Hildesheim eine Strecke von ca. 150 km bis zur Lüneburger Heide zurücklegen mußten, fuhren wir gegen 8 Uhr 30 los und waren gegen 10 Uhr 30 in Undeloh. Den größten Teil legten wir auf der Autobahn A7 in Richtung Hamburg zurück. Nach Undeloh gelangten wir über die Ausfahrt Nr. 41 "Egestorf". Für die geplante Kutschfahrt um 10 Uhr 30 war uns die Kutsche zu voll. Deshalb wählten den folgenden Termin um 11 Uhr 30. So hatten wir etwas Zeit, uns in dem schönen Heidedorf Undeloh (das zentral in der Lüneburger Heide liegt) umzusehen.
In der Touristinformation kaufte Jutta einige Postkarten, die sie an Freunde und Bekannte verschickte. (Photos "Undeloh")
|
Jutta und die Postkartengrüsse |
|
|
Planmäßig startete die vollbesetzte, offene Pferdekutsche zu dem Ausflug in die Lüneburger Heide bzw. zum Wilseder Berg. Dafür benötigte der Kutscher ca. 2 Stunden. In Wilsede hatten wir zusätzlich eine Pause von 50 Minuten zur freien Verfügung. Kurz nach Undeloh waren wir mitten in der Lünebürger Heide. In den Monaten August und September blüht die Heide. Wir hatten also den richtigen Zeitpunkt getroffen, denn die Heide leuchtete bezaubernd schön. (Photos "Lüneburger Heide")
|
Kutschverkehr in der Lüneburger Heide |
|
|
In Wilsede (in der Nähe liegt der Wilseder Berg mit 169 m Höhe) gab es erst einmal eine kleine Mahlzeit: Currywurst mit Pommes Frites und ein Weizenbier bzw. ein Cola. Nach dieser Stärkung wanderten wir in den Totengrund, wobei wir allerdings etwas in Zeitnot kamen, da die Kutsche bereits für die Rückfahrt auf uns wartete. (Photos "Wilsede")
Bauernhaus in Wilsede
|
|
Auf dem Rückweg genossen wir noch einmal die herrliche Landschaft und fanden auch interessante Fotomotive. Um 14 Uhr 30 waren wir wieder in Undeloh. Eigentlich wollten wir uns noch an einem Baggersee erfrischen (wir haben im Sommer die Badetasche immer im Auto). Man konnte uns aber nur das schöne Freibad empfehlen.
Also entschlossen wir uns, wieder nach Hause zu fahren und den Rest des Tages bei kühlen Getränken auf dem schattigen Balkon zu entspannen. Die Rückfahrt klappte problemlos (es gab sehr viel weniger Verkehr als auf der Hinfahrt) und wir waren um 16 Uhr wieder in Hildesheim.
Trotz der drückenden Hitze von über 30 grd. C war uns ein sehr interessanter und eindrucksvoller Ausflug (den Jutta im Detail geplant hatte) in die Lüneburger Heide (wo es im Wald etwas kühler war) gelungen.
Fotos und Text: Klaus Metzger
12. Mit dem Fahrrad entlang der WESER
|
Weser-Personenfähre (Würgassen-Herstelle) |
|
|
Seit längerer Zeit hatten wir eine Radtour entlang der Weser geplant. Am April-Wochenende vom Samstag, den 20. bis Montag, den 22. war es soweit.
Kurzfristig hatten wir auch zwei Übernachtungen in dem kleinen Ort Wehrden an der Weser organisiert. Unsere Fahrräder waren schnell verstaut, denn unser OPEL Combo Tour ist ein vielseitiges Fahrzeug, in dem wir auch schon übernachtet haben. (Reisebericht "Timmendorfer Strand") Bei sehr schönem Wetter fuhren wir gegen 9 Uhr in Hildesheim los.
|
Unser OPEL Combo Tour am Wohldenberg |
|
|
Die Gesamtstrecke von ca. 90 km führte uns über Holzminden, Höxter bis nach Beverungen. Unterwegs fuhren wir an Wehrden vorbei, wo wir unser Quartier reserviert hatten. Wir waren um 11 Uhr 30 an der Weser. Vorher kauften wir im Supermarkt Getränke und Lebensmittel ein, denn wir wollten uns an diesem Wochenende selbst versorgen.
|
Das Fährhaus |
|
|
Der erste Eindruck von der Weser bei Beverungen war sehr entspannend. Intuitiv hatten wir als Parkplatz die Gegend am Fährhaus gewählt, wo sich auch die Dampferanlagestelle befindet. Meine zweite Frau, Jutta Hartmann-Metzger, betätigte sich erst einmal als Tierfotografin mit beachtenswerten Ergebnissen. (Bilder "Tierleben an der Weser")
|
Tierleben an der Weser |
|
|
Wir unternahmen noch einen kleinen Spaziergang ins Zentrum von Beverungen. Dort befindet sich das Rathaus mit dem Renaissance-Giebel, der Michelisbrunnen, das Cordt-Holstein-Haus (1662). die katholische Barockkirche St. Johannes der Täufer (1698) und das Alte Fährhaus (17. Jhdt.). (Reisetipp "Stadtzentrum von Beverungen") Insbesondere in der kath. Pfarrkirche fanden wir sehr schöne Fotomotive. (Bilder "Beverungen")
Jutta machte mich darauf aufmerksam, dass wir uns an der Weser an der "Strasse der Orgelbauer" befinden würden. Die Orgelroute ist geprägt durch Kirchen mit den meist erhaltenen historischen Orgeln des 17. und 18. Jahrhunderts. Diese Route beginnt in Höxter mit der Killani-Kirche und ist ca. 118 km lang.
Sie führt weiter über Corvey (Klosterabtei) mit der Weddemann-Orgel und nach Godelheim mit der Königin unter den Orgeln von Andreas Schneider. Dann geht es weiter nach Amelunxen mit einer Orgel aus dem Jahr 1681 und bis nach Beverungen mit der kath.Pfarrkirche (mit einer Orgel von Johann Möller aus dem 17. Jhdt.). In Wormeln befindet sich in der Klosterkirche eine Orgel von Wilhelm Schneider. Dies ist die östliche Route.
Kath. Pfarrkirche in Beverungen
|
|
Die westliche Route führt von Wormeln über Pechelsheim, Willebadessen, Neuenheerse, Brakel, Pombsen, Ovenhausen zurück nach Höxter. Alle Orgeln sind in der Tradition der westfälischen Orgelbauerfamilie Bader gebaut worden. Dieser Orgelbau hatte überregionale Bedeutung in der Zeit des Barocks und unterscheidet sich vom norddeutschen und französisch-rheinischen Orgelbaustil.
Dampferanlagestelle in Wehrden
|
|
Nach diesem Ausflug in den Orgelbau war es am Samstag gegen 13 Uhr 30 Zeit, in unser reserviertes Quartier nach Wehrden zu fahren. Deshalb legten wir die Strecke nach Höxter noch einmal kurz (ca. 5 km) zurück, um nach Wehrden zu gelangen.
Die preiswerte Übernachtungsmöglichkeit in der Pension "Zum Mönchsgarten" (Pension "Zum Mönchsgarten") gefiel uns sehr gut. Der Ausblick von unserem Zimmer im 2. OG direkt auf die Weser war beeindruckend. Und diese Ruhe...! (Bilder "Wehrden")
Auch am Sonntag enttäuschte uns das Wetter wieder nicht, denn es war herrlicher Sonnenschein. Also ideale Bedingungen für unsere geplante Radtour in Richtung Bad Karlshafen (stromaufwärts). Für die Getränke und das Regenzeug hatte ich meinen Rucksack dabei. Das Hinweisschild am Radweg R99 in Wehrden (am Startpunkt) zeigte die Entfernung nach Bad Karlshafen mit 17 km an.
Der erste Stopp war in dem bereits bekannten Beverungen, wo Jutta die Toilette bei der Touristinformation aufsuchte. Dann kamen wir auf der Radtour am stillgelegten Kerrnkraftwerk Würgassen vorbei. Kurz danach mußten wir auf die andere Weserseite, um nach Bad Karlshafen zu gelangen. Wir hatten die Wahl über die Brücke oder über die kleine Weser-Personenfähre (max. 10 Fahrgäste). Wir entschieden uns für die Letztere. (Reisetipp "Kleine Fähre")

Der Fährmann
|
|
Wir waren die einzigsten Fahrgäste, die mit den Rädern über die Weser von Herstelle über Würgassen gebracht wurden. Die Überfahrt kostete 1 Euro p. P. (mit Fahrrädern). Aus Freude über das Erlebnis gab Jutta dem Fährmann noch zusätzlich 5 Euro Trinkgeld. Von der gegenüberliegenden Seite (in Würgassen) hatte man einen schönen Eindruck von Herstelle, der ältesten Ortschaft im Stadtgebiet Beverungens. (Bilder "Kleine Fähre")
Dreiländereck
Ganz in der Nähe war ein Felsen mit einer Tafel, die auf das Dreiländereck "Hessen/Niedersaschsen/Nordrhein-Westfalen" verwies. Wir kamen mit den Rädern an den 100 m hohen Hannoverschen Klippen (aus Sandstein) vorbei und konnten die imposante Plattform des "Weser-Skywalk" erkennen.

Jutta will noch nicht weiterfahren
Über die Brücke bei Lauenförde fuhren wir zurück nach Beverungen und von dort über den linksseitigen Radweg R99 wieder zum Ausgangspunkt in Wehrden. Ohne größere Schwierigkeiten hatten Jutta und ich eine Strecke von 35 km absolviert. Wir erinnerten uns an unsere ersten Radtouren auf Föhr. Am Ende meines Bornholm-Berichtes (Bornholm) habe ich darüber und über unsere Touren in Österreich geschrieben.
Nun waren wir auch schon in Bad Karlshafen. Nach einer kuzen Pause fuhren wir am rechten Weserufer wieder zurück. Im Biergarten des"Yachthafens Dreiländereck" legten wir eine Rast ein, tranken ein erfrischendes Radler und verzehrten Bratkartoffeln mit Sauerfleisch. (Reisetipp "Yachthafen") Die Aussicht über den Yachthafen war sehr schön und man bekam ein erstes Gefühl vom kommenden Sommer. (Bilder "Yachthafen")
|
|
Am Montag (22. April 2013) war der Tag unserer Heimreise. Wir fuhren über Holzminden und kamen am Schloss Corvey vorbei. Dort waren wir erstmals vor ziemlich genau 16 Jahren (April 1997). Wir hatten uns am 20. Februar 1996 kennengelernt (siehe "Bornholm-Bericht") und danach fast alle Schlösser der näheren Umgebung besichtigt: Schloss Bückeburg (Schloss "Bückeburg"), Schloss Wolfenbüttel, Schloss Sanssouci (Schloss "Sanssouci") und Schloss Corvey. (Schloss "Corvey") In meiner Empfehlung (Reisetipp "Schloss Corvey") bin ich die Geschichte des Schlosses eingegangen. Gegen 13 Uhr waren wir wieder wohlbehalten in Hildesheim.
Text und Fotos: Klaus Metzger
|
|
|
|
|
|
13. Schlösser und Strände an der Dänischen Riviera
|
|
Wachwechsel beim Schloss Fredensborg
In den Jahren von 1977 bis 1980 habe ich bei der dänischen Firma Niro Atomizer A/S (Ingenieurfirma für Sprühtrocknungsanlagen) in Kopenhagen gearbeitet und wohnte mit meiner Familie in Alleroed (ca. 20 km nördlich von Kopenhagen).
Dies war eine sehr schöne Zeit mit ausgezeichneten Kontakten zu meinen dänischen Kollegen. Mit ein Grund war sicherlich von Anfang an mein Bemühen, die dänische Sprache zu lernen. Dies klappte so gut, dass ich mich auch jetzt noch während unseres Urlaubes sehr gut verständlich machen konnte.
Wir lernten die nähere Umgebung kennen und fuhren im Sommer gerne zum Baden über den Hafenort Gilleleje nach Tisvildeleje (ca. 40 km von Alleroed entfernt). Auch das Schloss Kronborg haben wir mehrmals besucht. Es war naheliegend, im Sommer 1977 von Kopenhagen aus über Schweden, Finnland nach Norwegen zum Nordkap zu fahren. (Reisebericht "Von Kopenhagen zum Nordkap") Dadurch betrug die Gesamtstrecke nur 5.300 km gegenüber 7.300 km bei der Anreise aus Süddeutschland (Karlsruhe), von wo wir Anfang 1977 nach Kopenhagen umgezogen waren.
Mit dem Fahrrad und Zelt erlebten mein Sohn Jochen (damals 8 Jahre alt) und ich im Sommer 1979 die dänische Insel Bornholm, die unterhalb von Schweden liegt und damals mit der Fähre von Kopenhagen aus in ca. 7 Stunden zu erreichen war. (Reisebericht "Bornholm") Damit war unsere Zeit in Dänemark aber fast wieder beendet, denn 1980 wurde ich als Technical Manager in die Niederlande versetzt. Wir wohnten bis 1984 in Gouda.
Danach verbrachten wir mehrere Jahre unsere Ferien im Sommerhaus unserer Freunde Finn (ein dänischer Arbeitskollege) und Randi auf der Ostsee-Insel Samsoe. Diese Zeit endete 1985.
Nun sollte ich also mit meiner 2. Frau, Jutta Hartmann-Metzger, nach fast 30 Jahren wieder nach Seeland (Kopenhagen liegt auf der Insel Seeland) reisen, um in einem gemieteten Ferienhaus (in der Nähe von Gilleleje) eine Woche Urlaub zu machen. Ich war sehr gespannt, wie ich alles erleben würde. Ich kann aber jetzt schon sagen: "Es war ein wunderschöner Urlaub!".
Blick vom Zimmer im AKZENT Hotel Schleswig
|
|
Aus entfernungsmässigen Gründen (bei einer Gesamtstrecke von 770 km) unterbrachen wir die Anfahrt in Schleswig, wo wir im AKZENT Hotel Strandhalle übernachteten. (Hotelbewertung "AKZENT Hotel Strandhalle") So starteten wir ausgeruht am Samstagmorgen, den 22. Juni 2013, zu unserer Fahrt nach Nord-Seeland. Zum ersten Mal benutzten wir die Storebaeltsbrücke, für die wir eine Maut von 235 Dkr bezahlen mussten.
Alles klappte hervorragend bis nach Hilleroed. Von dort wurde es schwierig, den richtigen Weg nach Gilleleje zu finden. Auf meine alten Erfahrungen aus meiner dänischen Zeit konnte ich mich nicht mehr berufen, denn vieles hat sich verändert. Nach einigem Hin und Her fanden wir dann doch den dänischen Vermieter NOVASOL - einige Kilometer außerhalb von Gilleleje (die Wegbeschreibung von NOVASOL war irreführend).
|
|
Gegen 14 Uhr 30 konnten wir erstmals unser Ferienhaus in Dronningemölle in Augenschein nehmen. Es war sehr modern eingerichtet - mit Sauna und Whirlpool. Auch die Lage im völlig abgetrennten Bereich, der nicht eingesehen werden konnte, war optimal. Die Privatbahn von Gilleleje von Helsingör, die in regelmässigen Abständen auf oberhalb liegenden Gleisen vorbeifuhr, störte uns nicht besonders. Von Anfang an hatten wir einen Hausgast: eine etwas größere Maus. Sie erschien immerwieder sehr neugierig an der Schlafzimmertüre und verschwand dann wieder. Selbst Jutta konnte damit leben (in Indien mussten wir uns 2007 in einem vornehmen Hotel mit Ratten herumschlagen: (Reisebericht "Indien")
|
Der einsame Strand bei Dronningmölle |
|
|
Der Sonntag, der 23. Juni 2013, war ideal für die erste Strandbesichtigung. Dazu war eine kleine Wanderung von ca. 600 m erforderlich, denn unser Ferienhaus lag in einem abgelegenen Waldstück. (Bilder "Dronningmölle Strand") Wir hätten auch mit den Fahrrädern radeln können , die im Schuppen zur Verfügung standen.
An diesem Tag benutzten wir auch erstmals die Sauna und den Whirlpool. Die Anweisungen in Deutsch und Dänisch waren gut verständlich und wir fanden uns sehr schnell zurecht.
In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass wir beim Vermieter eine Kaution in Höhe von 150,- Euro für den Stromverbrauch (den jeweiligen Stand am Stromzähler mussten wir notieren und bei der Abreise abgeben) hinterlegen mussten. Zwei Wochen nach unserer Rückkehr bekamen wir 120,- Euro (bei einem Verbrauch von 93 kWh) zurückerstattet. Dies verlief also absolut korrekt.
Für den Montag, den 24. Juni 2013, war der Besuch des Kronborg Schlosses in Helsingör geplant. An der Küste entlang über Hornbaek war es leicht zu erreichen. Vorher wollten aber erst noch nach Gilleleje (Bilder "Gilleleje Hafen") fahren, um Geld zu wechseln und frischen Fisch am Hafen zu kaufen. (Reisetipp "Gilleleje Hafen") Auf dem Weg zum Hafen kamen wir auch an interessanten, älteren Wohnhäusern vorbei. (Bilder "Ältere Wohnhäuser")
|
Der Hafen von Gilleleje |
|
|
Einige Worte zum leidigen Geldwechseln: Obwohl Dänemark zur EU gehört, hat man dort immer noch die dänische Krone. Im Gegensatz zu anderen Ferienländern akzeptieren die Dänen den EURO nur ausnahmsweise. Und dann nur Scheine (wie auf der Storebaeltsbrücke); Münzen werden keine entgegengenommen. Wir hatten eine größere Summe DM, die gewechselt werden mussten. Das kostete bei Bank jeweils 35 Dkr (ca. 5 Euro) Wechselgebühr! Sinnvoll ist das Wechseln in Dkr bei der Hausbank vor der Abreise.
Das Schloss Kronborg
|
|
Bei der Besichtigung des Kronborg Schlosses wandelte ich auf "alten Spuren". Völlig verändert hatte sich die Gegend um das Schloss in Richtung Stadt: Die alte Werft, die man bei der Einfahrt mit der Fähre von Helsingborg (Schweden), sehr deutlich sehen konnte, war in der Zwischenzeit verschwunden. Dort befindet sich jetzt der Kronborg Kultur Hafen. (Bilder "Schloss Kronborg")
Das Renissanceschloss Kronborg wurde in der Zeit von 1574 bis 1585 von König Frederik II an der engsten Stelle des Öresunds (zwischen Dänemark und Schweden) gebaut. Hier mussten die Handelsschiffe aus aller Welt dem dänischen König Zoll für die Durchfahrt bezahlen. Wer sich dagegen wehrte, bekam die Kanonen des Schlosses, die auch heute noch besichtigt werden können, zu spüren. (Reisetipp "Schloss Kronborg")
|
Die Kanonen vom Schloss Kronborg |
|
|
Wer sich in die Kasematten begibt, der findet dort Kerkerzellen, Vorratskammern und Soldatenquartiere. Hier sitzt auch schlafend Holger Danske - wie König Barbarossa am Kyffhäuser - der darauf wartet, um im Kampf Dänemark zu Hilfe zu kommen.
Eine besondere Beziehung zwischen dem Schloss Kronborg und dem dänischen Sagenprinzen entstand durch William Shakespeare, der seine Hamlet-Geschichte wegen des Bekanntheitsgrades des Renaissance-Schlosses einfach dorthin verlegte.
|
Königlicher Raum im Schloss Kronborg |
|
|
Im Schloss befinden sich mehrere Ausstellungen, die den Reichtum verdeutlichen, den das viele Gold aus dem Sundzoll dem Herrscher einbrachte. Interessant sind auch die Gegenstände aus der Jugendzeit von Christian IV(dem Sohn von Frederik II) und über die Plünderung des Schlosses 1658 durch die Schweden. (Bilder "Gemächer im Schloss Kronborg")
|
Der Rittersaal |
|
|
Im Jahre 1629 kam es im Schloss zu einem fürchterlichen Brand. Christian IV liess das Schloss seines Vaters im ursprünglichen Stil wieder aufbauen. Deshalb können wir auch heute noch den schachbrettgemusterten Boden des Rittersaals bewundern. Mit einer Länge von 62 m gehört er zu den Längsten in Nordeuropa. In diesen königlichen Räumen lebte also König Frederik II mit seiner Frau, Königin Sophie.
Am Dienstag war wieder ein Tag mit Besorgungen: beim Brugsen in der Nähe kaufte ich Brötchen. Nach dem Frühstück fuhr ich nach Gilleleje, um erneut Geld zu wechseln. Der Besuch des Fotoladens war enttäuschend, denn ich suchte einen Ersatz für mein defektes NIKON-Teleobjektiv (50 bis 200 mm). Man hatte nur ein Tamron-Objektiv (70 bis 300 mm) zum Preis von 999,- Dkr. Ich war nicht überzeugt, dass es auf meine Kamera einwandfrei passen würde und behalf mir während dieses Urlaubes mit meinem Weitwinkel-Objektiv (18 bis 55 mm). In der Zwischenzeit habe ich mir in Deutschland ein SIGMA-Teleobjektiv (70 bis 300 mm) für 139,- Euro gekauft, mit dem ich sehr zufrieden bin. Im Super Brugsen kaufte ich Getränke und Joghurt. Übrigens sind alle Brugsen-Geschäfte 7 Tage geöffnet
|
|
|
|
Auf dem Nachhauseweg kam mir Jutta entgegen. Sie hatte Probleme mit den Augen und deswegen bereits mit NOVASOL telefoniert. Diese empfahlen die Apotheke in Gilleleje. Interessant war das Nummern-System: "Recepter eller Handköb". Ich entschied für das Letztere. Der Apotheker gab Jutta nach kurzer Schilderung Tropfen gegen Allergieprobleme. Der ganze Spaß kostete 70 Dkr und wirkte sofort. Ähnliches erlebte Jutta 2009 in Kenia, wo sie von einer indischen Ärztin eine "Zaubercreme" erhielt. (Reisebericht "Kenia")

|
Kloster Esrum |
|
|
Am Mittwoch, den 26. Juni 2013, stand wieder das Thema "Kultur" auf dem Plan. Der Himmel war leicht bedeckt (bei 16 grd. C) - ideale Bedingungen für die vorgesehenen Besichtigungen. Auf dem Weg nach Hilleröd lag das interessante Kloster Esrum mit dem Möllegaard (Mühlenhof). Es wurde 1151 von französischen Zisterziensermönchen gebaut, die eine Klostergemeinschaft aufbauen wollten. Im Mittelalter zählte dieses Kloster zu den Bedeutendsten in Skandinavien. Allerdings haben die Mönche noch vor der Reformation dieses Kloster wieder verlassen. (Bilder "Kloster Esrum")
|
Der Klostergarten |
|
|
Die jährliche Attraktion ist der Rittermarkt, der am 24. bis 25. Juni stattfand. Wir hatten diesen verpasst - konnten aber immer noch verschiedene Stände und die Reitanlage erkennen. Im Kloster lässt eine Ausstellung das Leben der Mönche wiedererstehen. Ein eindrucksvoller Klostergarten fand das grosse Interesse Jutta's, die sich seit längerer Zeit mit Kräuterpflanzen befasst. (Reisetipp "Kloster Esrum")

|
Schloss Frederiksborg |
|
|
Wir freuten uns schon auf das nächste Schloss, das sehr malerisch mit einem Barockgarten am Schloss-See bei Hilleröd liegt.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich nun - nach der erstmaligen Besichtigung des Esrum-Klosters - diese "Perle" unter den dänischen Schlössern zum ersten Mal besichtigte. Mit meiner zweiten Frau, Jutta Hartmann-Metzger, habe ich über die Jahre andere Interessen und Schwerpunkte entwickelt. (Bilder "Schloss Frederiksborg")
|
Der Neptun-Springbrunnen |
|
|
Diese einzigartige Renaissance-Anlage wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts von Christian IV (dem Sohn des Schloss Kronborg - Erbauers Frederik II) gebaut. Die Bedeutung des dänischen Königs als mächtiger nordeuropäischer Monarch lässt sich an vielen dekorativen Elementen dieses Schlosses erkennen. Es sind die Statuen und die Reliefs, der Neptun-Springbrunnen und die Marmorgalerie im Königsflügel. (Bilder "Nationalhistorisches Museum")

|
Die Schlosskirche |
|
|
Im 18. Jahrhundert verlor das Schloss seine Bedeutung als Residenz des Königs. Es wurde für Repräsentationszwecke immer noch verwendet. Während der Zeit des Absolutismus zwischen 1660 bis 1848 wurden alle dänischen Könige in der Schlosskirche gesalbt.
Audienzsaal
|
|
Ein schlimmes Feuer zerstörte 1859 grosse Teile des inneren Schlosses. Für die Wiederherstellung wurden landesweit Gelder eingesammelt, Lotterien veranstaltet und private Spenden entgegengenommen. Selbst J.C.Jakobsen, der Gründer der bekannten Carlsberg-Brauerei, beteiligte sich aktiv an dem Projekt. und schlug 1877 vor, das Schloss zum Sitz des nationalgeschichtlichen Museums zu machen.
So finden sich hier Historiengemälde, Porträts, Möbel und Kunsthandwerke über 500 Jahre dänischer Geschichte. Für die Besichtigung sollte man sich mindestens 2 Stunden Zeit nehmen. (Reisetipp "Schloss Frederiksborg")
|
Der einsame Strand von Hornbaek |
|
|
Am darauffolgenden Donnerstag besuchten wir wieder ein interessantes Schloss: Fredensborg Slot. Auf dem Weg dorthin legten wir in Hornbaek (durch das wir bereits am Montag auf dem Weg nach Helsingör gefahren waren) eine Pause ein, um uns am bekanntesten Badeort an der Nordküste (Dänische Riviera) den Strand anzusehen. (Bilder "Hornbaek Strand")
Im Vergleich zu den besuchten Stränden von Gilleleje und Dronningmölle war dieser sehr breit und gepflegt. Was uns auch hier - wie an den anderen Stränden - auffiel, waren die fehlenden Strandspaziergänger (von Badegästen will ich bei einer Wassertemperatur von 16,5 grd. C nicht sprechen).Sollte auch in Dänemark das Geld nicht mehr so locker sitzen? Übrigens stand unser schönes Sommerhaus zum Verkauf. Und dies war an der ganzen Küste kein Einzelfall. (Reisetipp "Gepflegter Strand an der Dänischen Riviera")
|
Königliche Leibgarde vor dem Schloss Fredensborg |
|
|
Das Schloss Fredensborg wurde von König Frederik IV nach dem Ende des Nordischen Krieges ab 1772 zum Gedenken an den Friedensschluss gebaut. Das Schloss sollte seine neue Sommerresidenz werden, da das Schloss Rosenborg in Kopenhagen seine ruhige Lage verloren hatte. Heute hält sich die Königliche Familie eines Großteil des Jahres im Barockschloss auf. Dann bringen sie auch die Königliche Leibgarde mit. Kurz vor 12 Uhr findet regelmässig der eindrucksvolle Wachwechsel statt. Bei besonders festlichen Änlässen spielt das Musikkorps der Königlichen Leibgarde im Schlosspark. (Reisetipp "Schloss Fredensborg")
|
Wachwechsel |
|
|
Von Dänen erfuhren wir, dass wir zufällig einen derartigen Anlass miterleben durften, denn die Königsfamilie verabschiedete sich von der Königlichen Leibgarde, da sie nach Jütland in Urlaub fahren wollte. Nach einiger Wartezeit erschien der königliche Jaguar und der Prinzgemahl Henrik stieg aus.
Noch etwas später öffnete sich die Eingangstüre zum Schloss und er kam mit seinem Dackel und dem Hofmarschall (mit der roten Jacke) die Steintreppe herunter. Das Musikkorps und die Soldaten marschierten vorbei. Danach winkte er uns kurz zu und verschwand wieder im Schloss. Er hatte also die Repräsentationspflichten für die Königsfamilie übernommen. (Bilder "Wachwechsel")
Königliche Verabschiedung in den Urlaub
|
|
Nach Meinung der dänischen Tourismus-Fachleute (siehe Broschüre "Nordseeland - Königliche Erholung in Dänemark" 2012, 91 Seiten) kann man sich auf Nordseeland blendend erholen und vorzüglich weiterbilden. Wir können das aufgrund unserer eigenen Erfahrungen bestätigen und sind mit unserer Meinung nicht allein. Schon die dänischen Könige zogen ab dem 16. Jahrhundert gerne von Kopenhagen in dieses "Naherholungsgebiet", um zu jagen und sich zu entspannen. Sie bauten sich nach und nach die Schlösser, die wir besucht haben.
|
Dronningmölle Strand |
|
|
Am Freitag war der letzte Tag unserer herrlichen Ferienwoche und wir verabschiedeten uns mit einer zweistündigen Wanderung von unserem Hausstrand. Obwohl das Wetter mit 20 grd. C (Wassertemperatur 16,5 grd. C) und leicht bedecktem Himmel relativ schön war, vermissten wir wieder die Badegäste.
Thomas Hotel in Husum
|
|
Am Samstag, den 29. Juni 2013, starteten wir gegen 8 Uhr mit unserer Heimfahrt. Da das NOVASOL-Büro erst gegen 10 Uhr öffnete, warfen wir den Schlüssel mit der Stromabrechnung in den entsprechenden Briefkasten. Auf der bereits bekannten Route fuhren wir wieder durch Dänemark und benutzten erneut die Storebaeltsbrücke (Maut 235,- Dkr). Diesmal unterbrachen wir unsere Rückreise in Husum (gegen 14 Uhr), wo wir ein Doppelzimmer im Thomas Hotel gebucht hatten. (Hotelbewertung "Thomas Hotel")
|
Besucher der Matjestage am Hafen |
|
|
Das Hotel lag in der Nähe des Binnenhafens. Dort war eine größere Veranstaltung. (Bilder "Matjestage am Binnenhafen") Im Hotel erfuhr ich später, dass es sich um die jährlichen Matjestage (Ende Juni) handelte. Mit Vergnügen mischten wir uns nach dem Einchecken unter die Besucher. Zuerst stillten wir am Hafen erst einmal unseren Hunger, denn wir hatten nach dem Frühstück noch nichts gegessen. Mit dieser schönen Veranstaltung konnten wir unsere erlebnisreiche Woche in Dänemark harmonisch abschliessen. (Reisetipp "Matjestage am Binnenhafen")
Unser Opel Combo Tour
|
|
Am Sonntagmorgen begaben wir uns auf die letzte Etappe. Alles verlief ohne Probleme und wir kamen gegen 12 Uhr in Hildesheim an. Noch ein paar Worte zu unserem Opel Combo Tour (Diesel), der uns wieder einmal sehr zuverlässig transportiert hat: Wir legten insgesamt 1.750 km zurück und verbrauchten nur 4,7 l Diesel/100 km. Ältere Vergleichswerte lagen bei 5,5 l Diesel/100 km. Vielleicht liegt es daran, dass ich auf der Autobahn nicht schneller als 100 km/h gefahren bin? Die Preise für Diesel waren in Deutschland und Dänemark annähernd gleich.
Siehe auch meinen BILDBAND ("Schlösser und Strände an der Dänischen Riviera")
Text und Fotos: Klaus Metzger
14. Kloster LOCCUM - auch eine Zisterzienser-Gründung
|
|
Marienaltar in der Stiftskirche von LOCCUM
Seit Jahren interessieren wir uns für die Klöster der näheren Umgebung. Im Rahmen von DIA-Vorträgen brachte ich die geschichtlichen Zusammenhänge dieser frommen Einrichtungen einem interessierten Zuhörerkreis (meistens Senioren) näher. Ich begann mit dem Kloster Marienrode (Reisetipp "Kloster Marienrode"), das ganz in unserer Nähe liegt. Wir besuchen auch gerne den Gottesdienst in der Klosterkirche St. Michael und meine Frau, Jutta Hartmann-Metzger, hat schon mehrmals an Exerzitien-Wochenenden im Kloster teilgenommen.
| Kloster Marienrode |
|
|
Das Kloster Marienrode bei Hildesheim wurde am 22. Mai 1125 durch den Hildesheimer Bischof Berthold I. von Alvensleben in der damaligen Siedlung Baccenrode (lat.: Novale Bacconis) gegründet. „Novale“ bedeutet zu bebauendes oder bereits bebautes Ackerland, etwa Neubruch, der erste Siedler könnte demnach Bacco geheißen haben. Es bestand bis 1259 zunächst als Augustiner-, später als Tochterkloster von Kloster Riddagshausen aus der Filiation der Primarabtei Morimond als Zisterzienser-Kloster. Die Zisterzienser gaben dem Ort den heute noch gebräuchlichen Namen Marienrode, nachdem Bischof Johann I. von Brakel im Jahre 1259 die Mönche und Nonnen des Klosters Backenroth wegen sittlichen Verfalls vertrieben hatte. Die Zisterzienser gaben dem Kloster den neuen Namen: Monasterium Novalis sanctæ Mariæ. (Quelle: WIKIPEDIA)
Nach der Säkularisierung 1806 wurde das Kloster geschlossen und die angeschlossene Domäne kam 1807 in den Besitz des Königreichs Westfalen unter Jerome Bonaparte. Dieser verpachtete die Domäne an den Calenberger Amtsschreiber Süllow und 1811 kaufte der königlich-westphälische Finanzminister Carl August von Malchus (ab 1813 Titel Graf von Marienrode) das Anwesen.
Seit Beginn seiner Amtszeit 1983 bemühte sich der Hildesheimer Bischof Josef Homeyer um die Gründung neuer Klöster im Bistum Hildesheim und so wurde das Kloster Marienrode am 5. Mai 1988 durch 10 Benediktinerinnen aus der Abtei St. Hildegard in Eibingen wiederbesiedelt, nachdem die vorherigen Bewohner und die Pächter des Gutshofs 1986 zum Auszug gedrängt worden waren.
Das Schloss Derneburg bei Hildesheim war ursprünglich ebenfalls ein Zisterzienser-Kloster, das ebenfalls mit der Säkularisierung im Jahre 1806 geschlossen wurde. ("Schloss Derneburg und die Natur") Für seine Verdienste beim Wiener Kongress schenkte König Georg III. im Jahre 1814 das verwahrloste ehemalige Kloster Derneburg und den Grundbesitz dem hannoverschen Minister Ernst zu Münster (1766 - 1839). Sein Sohn Georg Herbert (1820 bis 1902) wandelte von 1846 bis 1848 das Klostergebäude in ein Schloss um. Dabei konnte er - wie bereits sein Vater - auf die ausgezeichneten Dienste des hannoverschen Architekten und Oberhofbaudirektors Georg Ludwig Friedrich Laves zurückgreifen.
|
Schloss Derneburg (ehemals Kloster Derneburg) |
||
|
|
|
|
Im vergangenen Jahr waren wir Ende Juni für eine Woche in Dänemark und hatten uns auf Nordseeland (bei Dronningmölle) ein Ferienhaus gemietet. Das Wetter war durchwachsen - also eine ideale Bedingung für die Besichtigung der eindrucksvollen Schlösser auf der Insel Seeland. ("Schlösser und Strände an der Dänischen Riviera") Auf dem Weg zum Schloss Frederiksborg bei Holleroed entdeckten wir das ehemalige Zisterzienserkloster Esrum. (Reisetipp "Kloster Esrum")
Die Gebäude sind noch im urprünglichen Zustand erhalten und bilden die Kulisse für den jährlich stattfindenden Rittermarkt (24. und 25. Juni). Meine Frau, Jutta Hartmann-Metzger, war auch fasziniert von dem abwechslungsreichen Kräutergarten. (Bilder "Kloster Esrum")
Das Kloster Loccum liegt in der Nähe des Steinhuder Meeres, wohin schon öfters unsere Ausflüge geführt haben.
Kloster Esrum
Bei einer angenehmen Temperatur von 10 grd. C. und teilweise bedecktem Himmel fuhren wir Mitte März 2014 von Hildesheim über die Autobahn bis zur Ausfahrt Wunstorf. Von dort ging es über Land bis zum Kloster Loccum. Die Fahrtzeit betrug etwas mehr als eine Stunde.
|
Ehemaliges Abt-Gebäude |
|
|
Das Kloster wurde 1163 vom Mutterkloster Morimond (Burgund) als Zisterzienser-Kloster St. Maria und Georg gegründet. Es herrschte ein strenges Gepräge, das der geistige Vater, Bernhard von Clairvaux, festgelegt hatte.
Die Mönche verbesserten die Bewässerungstechnik über ein Kanalsystem. Allen Zisterzienzermönchen in den verschiedenen Klöstern gemeinsam ist der Fischfang in speziell angelegten Teichen (hier der Backteich).
|
|
Die Klosterkirche (heute Stiftskirche oder Pfarrkirche St. Georg) wurde 1240 bis 1280 erbaut. Sie besitzt einem kreuzförmigen Grundriss. Die dreischiffige turmlose Gewölbebasilika, bestehend aus dem Langhaus, dem Querhaus und dem gerade schließenden Chor folgt dem strengen Vorbild der französischen Zisterzienzer-Kirche Fontenay.
|
Der Altar |
||
|
|
|
|
Sehenswert sind der Kreuzgang und der figurenreiche Schnitzaltar (Anfang 16. Jahrhundert), ein hölzerner Reliquienschrein, die Mondsichel-Madonna aus Holz (2. Hälfte 15. Jahrhundert), die sich im seitlichen Marienaltar neben dem Schrein befindet. Interessant ist auch die Sandsteintaufe (1601) mit dem Apostelrelief. (Bilder "Stiftskirche")
|
Der Altar |
|
|
In den Außenanlagen des Klosters, wo sich kleine Bäche und Seen befinden, kann man wundervoll entspannen. Am Backteich entdeckten wir friedliche Enten und die seltenen Graugänse, die offensichtlich ihre längere Reise hier unterbrochen hatten. (Bilder "Wandern im Kloster Loccum")
Graugänse
|
|
In der Klosteranlage beginnt auch der Pilgerweg von Loccum nach Volkenroda (300 km) und ist sehr gut ausgeschildert. Pilgerpässe mit dem Stempel des Klosters für den Nachweis mit der Routenangebe liegen in der Stiftskirche aus.
Es war wirklich ein sehr erbaulicher Nachmittag in dieser spannenden Klosteranlage, die von den Zisterzienser-Mönchen vor mehreren hundert Jahren erbaut wurde.
Wir folgten den Spuren der Zisterzienzer bis nach Dänemark (Kloster Esrum auf Seeland) und konnten so ihre wichtige Aufgabe erkennen, den Menschen den christlischen Glauben nahezubringen.
|
Steinhuder Meer (August 2012) |
|
|
Wie ich bereits schrieb, liegt das Steinhuder Meer ganz in der Nähe. Deshalb fuhren wir nach dieser Besichtigung nach Steinhude, um dort das traditionelle Fischbrötchen (es wurden zwei, da sie lecker schmeckten) zu verspeisen. Und dann kauften wir noch zweí geräucherte Makrelen, wovon wir eine in Seelze bei Ernst (Jutta's Vater - er ist Witwer) ablieferten. Nach einem germütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen fuhren wir von Seelze wieder an Hause.
Text und Fotos: Jutta Hartmann-Metzger und Klaus Metzger
15. Erholung im Kloster HEGNE am Bodensee
|
|
Kloster Hegne (Haus St. Elisabeth)
Meine Frau, Jutta Hartmann-Metzger, hat schon mehrmals Exerzitien im nahegelegenen Kloster Marienrode erlebt und war begeistert. Nach diesen Kloster-Erfahrungen wollte sie ursprünglich alleine eine Woche (10. bis 17. Mai 2015) im Kloster Hegne am Bodensee verbringen.
Da attraktive Partner-Angebote zur Verfügung standen, entschlossen wir uns gemeinsam mit dem Wagen (und nicht mit der Bahn oder dem Bus) nach Süddeutschland zu fahren.
Unseren langjährigen Reisebegleiter, den Opel Combo Tour, hatten wir verkauft und von Jutta's Vater seinen gebrauchten Hyundai Matrix geschenkt bekommen. Mit diesem Wagen unternahmen wir nun die erste größere Reise an den Bodensee. Vom Diesel-Motor waren wir zum Benziner gewechselt, was ein noch besseres Tank-Management bedeutete. Zum Wagen gehörte auch ein NAVI (TomTom Start 20), das uns insbesondere in der Schweiz half, preisgünstige Tankstellen zu finden. Obwohl es unterwegs zu dieser Jahreszeit noch nicht so heiß war, zeigte die vorhandene Klima-Anlage bereits ihren Nutzen.
Wir hatten von vornherein festgelegt, dass wir die Strecke von Hildesheim bis zum Bodensee (ca. 700 km) nicht ohne Unterbrechung fahren würden. Da wir auf dem Friedhof Brühl (bei Mannheim) das Grab meiner Eltern besuchen wollten, hatten wir im 10 km entfernten Hockenheim ein Doppelzimmer im ACHAT Comfort Hotel reserviert. Nach einer Fahrtzeit von 4 h und einer Strecke von ca. 420 km erreichten wir gegen 13 Uhr den Brühler Friedhof. Auf dem Grab meiner Eltern hinterließen wir einen Topf mit bunten Blumen (es war an diesem Sonntag auch Muttertag) und nahmen uns Zeit für einen Spaziergang über den weiträumigen Friedhof.
|
Das Urnengrab meiner Eltern (gestorben 2002) |
||
|
|
|
|
Ich entdeckte das Grab des katholischen Pfarrers Karl Diethrich, der 1975 im Alter von 60 Jahren verstorben war. An ihn habe ich während meiner Schulzeit in Brühl eine sehr zwiespältige Erinnerung, denn ich empfand ihn als sehr streng, aber gerecht. An diesem Beispiel erkannte ich auch, dass ich zu vielen Gräbern keinen Bezug mehr hatte, da ich bereits 1967 aus Brühl wegzog.
Das Grab meines Großvaters, Jakob Metzger, war leicht zu finden, denn es befand sich mit dem einheitlichen Kreuz (geboren 1893 und gestorben 1958) bei den Kriegsgräbern, da er am 1. Weltkrieg teilgenommen hatte.
Er starb nach kurzer, schwerer Krankheit im Mannheimer Krankenhaus. Es war meine Aufgabe als 14-Jährigem, mich während seines Krankenhausaufenthaltes um meine trauernde und einsame Großmutter (väterlicherseits) zu kümmern (ich übernachtete auch bei ihr).
Ich kannte zwar Hockenheim aus meiner Jugendzeit und erlebte mehrere Motorradrennen (damals gab es dort noch keine Autorennen) an der Rennstrecke, aber nun hatte sich wirklich alles verändert. Unser Hotel lag mitten im Industriegebiet. Es war alles sehr laut und auf dem Zimmer gab es keine Klima-Anlage. Aber wir fanden einen großen Ventilator, den Jutta zum Trocknen ihrer Bluse zweckentfremdete. Das Abendessen gönnten wir uns im griechischen Restaurant Delphi in der Schwetzinger Str. 1 (auch dies fanden wir nur mit unserem NAVI). Nach diesem ersten Tag, der unsere Orientierung herausforderte, freuten wir uns auf die Weiterreise.
Als wir am Montag bei Hockenheim auf die Autobahn fuhren, überraschte uns der beträchtliche LKW-Verkehr (als ob alle gleichzeitig losgefahren wären, denn am Sonntag war ja LKW-Fahrverbot).
Erst nach der Autobahn-Abzweigung vor Stuttgart in Richtung Singen war das Fahren wieder entspannter und ermöglichte auch einen kurzen Blick in die schöne Landschaft. Nach 3,5 Stunden Fahrt und einer Entfernung von 380 km hatten wir über die Bundestrasse 33 das Kloster Hegne bei Allensbach erreicht.
|
Kloster Hegne am Bodensee |
||||
|
|
|
|
|
|
Da wir unser Zimmer 212 erst gegen 15 Uhr beziehen konnten, nutzten wir die Zeit für einen Abstecher ins schweizerische Kreuzlingen, um dort unseren Tank mit dem sehr viel preisgünstigeren Benzin E 10 zu füllen (der Preisunterschied zu Konstanz betrug bis zu 20 Cent/l). Der durchschnittliche Verbrauch lag bei 7 l/100 km (dieser wurde auf der Rückfahrt noch auf 6,4 l/100 km verbessert. Wie bereits erwähnt, konnten uns in der Schweiz auf unser NAVI vertrauensvoll verlassen.
In Konstanz machten wir noch einige Einkäufe bei ALDI. Ein kurzer Besuch der Insel Reichenau (diese war über einen breiten Damm mit dem Auto erreichbar) brachte uns nicht allzuviel, denn der Uferbereich war verbaut und man kam nur äußerst beschwerlich ans Wasser. Mir genügte die Freude aus der Ferne, denn von unserem Zimmer hatte man einen sehr schönen Blick auf die Insel. Im Wohnbereich (Haus St. Elisabeth) des Klosters Hegne fühlten wir uns von Anfang an sehr wohl. Bilder "Kloster Hegne"
|
Insel Reichenau im Untersee |
|
|
Am Dienstag wollten wir erstmals etwas unternehmen. Mit unserer Gästekarte, für die wir 8 Euro p.P. bezahlt hatten, konnten wir die Busse und Bahnen der Umgebung kostenlos benutzen. Als wir 2008 unser Quartier am Titisee aufgeschlagen hatten, gab uns die Schwarzwald-Gästekarte ähnliche Möglichkeiten (wir fuhren z.B. mit der Bahn bis zum Rheinfall von Schaffhausen in der Schweiz).
Wir hatten uns zuerst die Insel Mainau ausgesucht und wurden bei dem sehr schönen Wetter von der Blumeninsel nicht enttäuscht. Vor über 56 Jahren besuchte ich mit meinen Freunden im Rahmen einer längeren Radtour die Insel Mainau. Wir zelteten in der Nähe. Leider entsprach der Camping-Platz an der Insel Mainau nicht unseren Wünschen, denn das Wasser war sehr trübe und schlammig. In meinem Reisebericht "SKANDINAVIEN - von Kopenhagen zum Nordkap!" habe ich auch die Geschichte des Mainau-Besitzers, Graf Bernadotte, erwähnt. Nordkap-Tour Heute führt allerdings seine Tochter Bettina das Regiment und präsentiert auch nach draußen das Geschlecht der Bernadotte von der Insel Mainau.
|
Bernd, Hans, Karl und ich (1959 auf der Radtour zum Bodensee) |
|
|
Auf der gegenüberliegenden Seite in Ludwigshafen am Bodensee fühlten wie uns wohler und blieben auf dem dortigen Camping-Platz bis zum Montag, den 24. August 1959. Die nächste Station war Ravensburg mit einem wunderschönen Camping-Platz an einem kleinen Badesee. Fast 20 Jahre später hatte ich beruflich öfters in Ravensburg zu tun, denn wir bauten bei der OMIRA-Molkerei eine neue Eindampfanlage. Eigentlich wollte ich mit meiner Frau, Jutta Hartmann-Metzger, den alten Campingplatz in Ludwigshafen am Bodensee besuchen. Nach den Erfahrungen von Hockenheim war ich mir aber nicht sicher, ob dieser überhaupt noch existiert. Das Risko und der Aufwand schien mir einfach zu hoch.
Haltestelle der Bahn "Seehäsle" (Blick von unserem Zimmer)
|
|
Doch nun zurück zu unserem jetzigen Besuch der Insel Mainau. Mit der Bahn "Seehäsle" fuhren wir zum Hauptbahnhof in Konstanz (Fahrtzeit ca. 20 min) und dann weiter mit dem Bus (Linie 4) bis zur Insel Mainau, die wir über eine kurze Landverbindung erreichten. Der Eintrittspreis von 19,- Euro p.P. war erst einmal schockierend. Wir dachten dabei an die weniger betuchten Familien mit mehreren Kindern, die sich einen derartigen Eintritt wahrscheinlich garnicht leisten können.
Das Schwedenkreuz am Weg auf die Insel Mainau
|
|
Wir nahmen uns für die Besichtigung sehr viel Zeit und genossen die herrliche Natur, für die die Insel Mainau so berühmt ist. Sehr beeindruckend fanden wir das "wohltemperierte" (tropische) Schmetterlingshaus, in denen zahlreiche bunte Schmetterlinge unterwegs waren. Jutta entwickelte mit der Kamera sehr viel Geduld und ihr gelangen schöne Aufnahmen. Das Können lag darin, abzuwarten, wann die Schmetterlinge ihren Flug unterbrachen und sich ausruhten.
Ich kann mich noch erinnern, dass ein farblich besonders interessanter Flieger leider nie zur Ruhe kam und damit nicht fotographiert werden konnte.
Schmetterling
|
|
Wir kamen am Restaurant Schwedenschenke vorbei (wie mit dem "Schwedenkreuz" sollte so die Verbindung zum schwedischen Geschlecht "Bernadotte" hergestellt werden, die ja in Stockholm immer noch sehr erfolgreich residieren). Der Weg führte uns weiter zum Barockschloss. Die Schlosskirche stand offen und lud zu einer Besichtigung ein. Im angebauten Palmenhaus entdeckten wir reife Orangen und Zitronen.
Von der Südspitze konnten wir weiße Passagierschiffe beobachten, die entweder an der Insel Mainau anlegten oder nach Meersburg ablegten. Bilder "Insel Mainau"
|
Blumenbeete |
|
|
Am folgenden Tag hatten wir auf dem Rückweg mit dem Schiff von den Pfahlbauten in Unteruhldingen nach Meersburg ausgiebig Gelegenheit, das Anlegemanöver im Hafen der Insel zu beobachten. Aber erst wollen wir uns noch einmal mit dem Besuch der Insel Mainau befassen. Für das Picknick fanden wer eine gemütliche Bank unter einem schattigen Baum. Diese Mittagspause genossen wir - auch um unsere berauschenden Eindrücke etwas zu verarbeiten. Danach begaben wir uns zurück in Richtung Ausgang. Wir kamen noch an einem kleinen Bauernhof mit niedlichen Pferden vorbei. Nach drei Stunden hatten wir unsere spannende Rundtour über die Insel Mainau beendet.
|
Barockschloss Insel Mainau (Anlegemanöver) |
|
|
Auf der rückwärtigen Seite des Hauptbahnhofs Konstanz befand sich der Fahrkartenschalter der "Weißen Flotte" Jutta organisierte für den folgenden Mittwoch die Schiffsreise nach Meeersburg und zu den Pfahlbauten nach Unteruhldingen.
Insgesamt kostete die gesamte Tour (einschl. des Eintritts für die Pfahlbauten) 51,- Euro. Es zeigte sich am folgenden Tag, dass auch diese Investition sich gelohnt hat. Auf jeden Fall war der erste Ausflugstag vom Kloster Hegne ein unvergessliches Erlebnis. Reisetipp "Insel Mainau"
Auch am Mittwoch enttäuschte uns das Wetter nicht. Es war ideales Reisewetter für unsere Schiffstouren und unsere Ausflüge. Im Fahrkartenschalter (im weißen BSB-Gebäude am Hafen) erfuhren wir, dass unser Schiff "Stuttgart" am Steg 7 um 9 Uhr 20 nach Meersburg ablegen würde. Reisetipp "Weiße Flotte" Da wir mit der Bahn gegen 9 Uhr eingetroffen waren, konnten wir uns noch etwas umsehen. Bilder "Hafen Konstanz" Die Überfahrt nach Meersburg dauerte 20 Minuten.
Die Autofahre nach Konstanz-Staad
|
|
Unterwegs beobachtete ich die Autofähren beobachten, die zwischen Meersburg und Konstanz-Staad pendelten. Vor 35 Jahren benutzte ich nach einem Kundenbesuch in Ravensburg die Autofähre von Meersburg nach Konstanz-Staad, um dann mit dem Mietwagen durch die Schweiz zum Flughafen Zürich zu gelangen und von dort in meine damalige Heimatstadt Kopenhagen zu fliegen. Die Überfahrt dauerte 15 min - jeweils im 15 Minuten-Takt. Auf dem Landweg um den Überlinger See beträgt die Entfernung 53 km und dauert 1 bis 1,5 Stunden. Die Fährverbindung besteht seit 1928 und ist mit dem Auto immer noch empfehlenswert. Bilder "Fährhafen Meersburg"
|
Meersburg und die Burg |
|
|
Langsam näherten wir uns dem malerischen Meersburg mit der berühmten Burg, die unübersehbar über der Stadt thronte. Obwohl wir noch nicht an unserem Ziel waren, stimmten wir uns bereits auf die Burgbesteigung ein und beoachteten vom Oberdeck eine größere Gruppe von Fährgästen, die unruhig auf den Einstieg in unser Schiff warteten. Wir überlegten uns, wo wir am Mittag den Weg zur Meersburg finden würden. Nach einer kurzen Pause fuhr die "Stuttgart" weiter nach Unteruhldingen, wo wir gegen 10 Uhr 20 eintrafen.
|
Pfahlbauten aus der Steinzeit (4.000 v. Chr.) |
|
|
Bereits bei der Annäherung mit dem Schiff konnte man das Freilichtmuseum mit den Pfahlbauten sehr gut erkennen. Mit einer Archäorama-Show wurden wir am Eingang zu den Pfahlbauten in die virtuelle Unterwasserwelt eingeführt. So entstand ein sehr guter Eindruck von dem Leben in der Stein- und Bronzezeit (4.000 bis 850 v. Chr). Mir imponierten auch die Taucharchäologen, die schemenhaft unter Wasser auftauchten, da ich in meinen jüngeren Jahren ebenfalls getaucht bin.
|
Totenfeier mit Schamanen |
|
|
Für die Erläuterungen im Rahmen der Führung konnten wir uns nicht besonders begeistern und so eroberten wir die unterschiedlichen Pfahlbauten (aus der Stein- oder Bronzezeit) auf eigene Regie. Im bronzezeitlichen Dorf "Unteruhldingen" (975 v. Chr.) entdeckten interessante, plastische Arrangements mit menschenähnlichen Figuren und Tieren. Besonders gelungen fanden wir die Totenfeier für einen reichen Stammesfürsten. Bilder "Pfahlbauten"
|
Der Steinzeitmensch von Unteruhldingen |
|
|
Nach über einer Stunde verliessen wir das Freilichtmuseum, um uns wieder zur Schiffsanlagestelle zu begeben. Wir hatten geplant, auf der Heimfahrt nach Hildesheim einen Zwischenstopp in Würzburg einzulegen. Jutta wollte das Quartier von zu Hause aus reservieren. Ich schlug vor, dies vor Ort bei der Tourismus Information in Würzburg zu erledigen. Da Jutta auf Nummer Sicher gehen wollte, rief sie nun von Unteruhldingen aus an. Dies gestaltete sich als äußerst kompliziert, da Würzburg nahezu ausgebucht war. Glücklicherweise bekamen wir noch ein Zimmer im "Chalet am Steinbachtal" in der Nähe Altstadt. Später schickte ich vom Kloster Hegne aus über den Gäste-Computer noch die gewünschte Bestätigung per e-mail.
|
Schülergruppe mit roten Mützen |
|
|
Wir hatten also die Wartezeit bis zur Ankunft unseres Schiffes optimal genutzt (in der Zwischenzeit war es auch recht warm geworden) und suchten uns deshalb ein schattiges Plätzchen auf dem Oberdeck. Obwohl wir zu unserer weiteren Station nach Meersburg wollten, nahm uns das Schiff erst einmal zur Insel Mainau mit. Das dortige Anlegemanöver habe ich bereits erwähnt.
Interessant war eine größere Schulklasse, die alle eine rote Mütze trugen, im Gänsemarsch das Boot sich bewegten, um voller Begeisterung die Insel Mainau zu besichtigen (die wir bereits am vorhergehenden Tag erlebt hatten).
|
Blick von der Meersburg |
|
|
Nach der Ankunft in Meersburg fanden wir relativ schnell den Aufstieg zur Burg Meersburg, die bereits am Morgen vom Schiff aus sehr deutlich zu erkennen war. Wir wußten, dass die bekannte Dichterin, Annette von Droste-Hülshoff, von 1841 bis zu ihrem Tode am 24. Mai 1848 hier gewohnt hatte. Es war die Burg ihres Schwagers Freiherr Joseph von Laßberg. Das Sterbezimmer, ihr Arbeitszimmer, das Vitrinenzimmer mit ihren Gedichtbänden und das Droste-Gedächtniszimmer konnten wir besichtigen.
|
Das Sterbezimmer |
|
|
Die Burg wurde im 7. Jhdt. vom Merowingerkönig Dagobert I. gegründet. Zur Burg führt eine 12 m lange Brücke, die im Torbereich als Zugbrücke konzipiert war. In der Nähe befindet sich die Schlossmühle, die immer noch ein oberschlächtiges Wasserrad aus dem 17. Jhdt. besitzt. Im Rahmen eines Rundganges durch mehr als 33 Räume kann man alte Ritterrüstungen und mittelalterliche Waffen in der Waffenhalle bewundern. Die Badestube vermittelt von außen einen Eindruck über die Gesundheitsansprüche der damaligen Bewohner. Die Burg ist immer noch bewohnt und zählt so zur Ältesten ihrer Art in Deutschland. Bilder "Burg Meersburg"
|
Ritterrüstungen |
|
|
Planmässig wollten wir nach diesen beeindruckenden Erlebnissen um 15 Uhr 05 mit dem Schiff von Meersburg nach Konstanz zurückfahren.
Da wir uns in der Nähe des Bootssteges aufhielten, überraschte uns die Ansage, dass ein Schiff um 14 Uhr 25 nach Konstanz ablegen würde. Dies hatten wir im Fahrplan übersehen. So waren wir bereits um 15 Uhr am Bahnhof und konnten um 15 Uhr 22 mit dem "Seehäsle" zum Kloster Hegne fahren.
Auch der 2. Ausflugstag vom Kloster Hegne war uns also rundum gelungen. Dazu paßte auch die deftige "Pilgerplatte" (roher Schinken, Käse, Salat, Gurke, Weizenbier), die wir nach der Ankunft im Kloster-Restaurant verspeisten.
|
Kloster Hegne |
|
|
Den folgenden Tag widmeten wir vollständig dem Kloster Hegne. Es war der Feiertag "Christi Himmelfahrt" und wir nahmen an der Messe um 9 Uhr 30 in der Klosterkirche teil. Im Gegensatz zur Klosterkirche Marienrode, die sich in der Nähe unseres Wohnortes befindet und die wir sehr gerne besuchen, fiel uns hier die Pracht der Heiligen Messe ganz besonders auf.
Ein angenehmer Ort der Stille war die Krypta, in der der Sarg der seligen Kreuzschwester Ulrika aufgebahrt ist.
|
Schwester Ulrika |
|
|
Im Haus Ulrika befindet sich eine Begegnungstätte, in der Kreuzschwestern für Rat suchende Menschen zur Verfügung stehen. Eine Tonbildschau und eine Ausstellung informiert über Leben und Wirken der verstorbenen Schwester Ulrika. Der angeschlossene Friedhof vermittelt einen Eindruck über die Generationen gläubiger Schwestern, die seit der Gründung 1895 im Kloster Hegne verstorben sind und im Zeichen des gemeinsamen Kreuzes beerdigt wurden.
|
Der Friedhof zum Kloster Hegne |
|
|
Jutta hat sich bei der Auswahl des passenden Klosters sehr viel Mühe gemacht. Als Ratgeber diente ihr der MERIAN guide Urlaub im Kloster .
Wie uns die erfreulichen Erfahrungen im Kloster Hegne (S. 143 bis 144) zeigten, hat sie - wie bei fast allen unseren Urlaubsreisen - die richtige Wahl getroffen. Diesen stimmungsvollen und entspannten Tag wollten wir mit einem schönen Essen beschliessen. An der Rezeption im Gästehaus St. Elisabeth empfahl man uns mehrere Restaurants in der Umgebung von Allensbach.
|
Unser Hyundai Matrix auf dem Parkplatz des Klosters |
|
|
Wir entschieden uns für das Restaurant Hofgut Kargegg in Langenrain. Erstmals fuhren wir wieder mit unserem Wagen und nur mit unserem NAVI fanden wir diesen abgelegenen Platz in der Nähe eines Golfplatzes. Für die Mühen mit der Anfahrt wurden wir im schönen Biergarten mit einem herrlichen Ausblick auf den Überlinger See entlohnt. Da Vatertag war bestellten wir den urigen Vatertagsspieß mit einer Salatbeilage. Zum Spieß gab es ein spezielles Bayreuther Bier, das mir aber garnicht schmeckte. Ich genoss das helle Weizenbier. Dieses Getränk ist für mich das Bier für den Sommer. Gegen 18 Uhr waren wir wieder im Kloster Hegne - mit dem Gefühl einen sehr erholsamen und entspanntenTag erlebt zu haben.
Der Freitag war als Einkaufstag mit einem Stadtbummel in Konstanz geplant. Leider regnete es ganz ordentlich, was uns aber nicht von unseren Plänen abhielt. Vor der Bahnfahrt nach Konstanz fuhr ich zuerst mit unserem Wagen zu ALDI, um den Proviant für die Rückreise zu besorgen. Ich mußte bis zur Öffnung des Marktes noch einige Zeit warten. Dabei fiel mir auf, dass unter den Wartenden - im Vergleich zu den ALDI-Markt in Hildesheim/Niedersachsen - eine größere Unruhe herrschte. Zeichnet uns eine größere Gelassenheit aus?
An der Auslage der Hotel-Rezeption fand ich ein gelesenes Exemplar der ZEIT. Ich nahm diese Wochenzeitung gerne mit, denn ich war bisher noch nicht dazu gekommen, mir die ZEIT zu kaufen (ich lese sie regelmäßig). Mit der Bahn "Seehäsle" trafen wir gegen 10 Uhr am Bahnhof in Konstanz ein. Jutta hatte sich eine "Shopping Map Konstanz" besorgt. Darauf konnte man alle interessanten Geschäfte in der Altstadt finden, die wir aufsuchen wollten. Aber zuerst besuchten wir das Konstanzer Münster, um stille Einkehr zu halten und uns ein wenig umzusehen.
|
Das Konstanzer Münster |
||
|
|
|
|
So gestärkt, konnten wir uns wieder hinaus in das unfreundliche Regenwetter begeben und die Stadtwanderung fortsetzen. Nun war das erste Ziel ein Bijou-Laden. Jutta liebt es, im Urlaub derartige Geschäfte aufzusuchen, um sich mit preiswertem Schmuck einzudecken. Ich stehe als Berater dann gerne mit Rat und Tat zur Seite. Die nächste Station war das Karstadt-Kaufhaus. Da das Aussuchen und das Probieren der gewünschten Kleidungsstücke bei Jutta immer eine längere Zeit in Anspruch nimmt, suchte ich mir einen gemütlichen Sitzplatz und wartete ab.
Offensichtlich fiel ich einem älteren Ehepaar auf, die mich ansprachen. Es waren echte Konstanzer "Ureinwohner". Sie hatten Bedenken, am Freitag in der Innenstadt einen Parkplatz zu finden. Ich sprach von meiner "intelligenten" Lösung, kostenlos mit der Bahn anzureisen. Das erstaunte sie sehr. Im Nu war für uns Ehegatten die Wartezeit überbrückt und ich ging mit Jutta noch in die Herrenabteilung, wo ich einige Freizeithemden für mich aussuchen durfte.
|
Das Konzilgebäude am Hafen |
|
|
In der Nähe des Bahnhofs befindet sich das Konzilgebäude. Zum Abschluß unserer Stadtbesichtigung wollten wir die Ausstellung im Konzilgebäude besichtigen.
Am Eingang fragte uns ein freundlicher Herr nach unseren Wünschen. Leider gäbe es im Monat keine Ausstellung, sagte er uns. Was wir sehr bedauerten. So begaben wir uns gegenüber in den Bahnhof und fuhren mit der Bahn um 12 Uhr 22 wieder zum Kloster Hegne. Trotz Regen fanden wir diesen dritten Ausflugstag vom Kloster Hegne voller interessanter Erlebnisse und Begegnungen (einschließlich der gekauften Erinnerungsstücke).
Nach fünf erholsamen Tagen im Kloster Hegne war am Samstag wieder die Zeit für die Rückreise angebrochen. Da wir eine Übernachtung in Würzburg - wie bereits beschrieben - telefonisch von Unteruhldingen aus reserviert hatten, war nur eine kurze Etappe bis zum Main notwendig. Wir fuhren auf der Autobahn an Stuttgart vorbei und über Heilbronn nach Würzburg. Mit unserem NAVI klappte die Orientierung wieder ganz ausgezeichnet. Zur Mittagszeit kam am Ziel in Würzburg an. Unsere B&B-Unterkunft Chalet am Steinbachtal lag sehr ruhig und war für eine Übernachtung ideal. Das Frühstück am kommenden Morgen fanden wir sehr stilvoll und diskret arrangiert.
|
Auf der Alten Mainbrücke |
|
|
Die Altstadt war nicht allzuweit vom Chalet entfernt. Wir mussten nur am Main entlang über die Alte Mainbrücke gehen, um in den älteren Teil von Würzburg zu gelangen. Dafür hatten wir am Samstagnachmittag ausreichend Zeit. Aber wir nicht das was wir erwartet hatten. Im Reisetipp "Altstadt Würzburg" habe ich mich dazu kritisch geäußert. Nach über 2,5 Stunden waren wir von unserer Stadtwanderung wieder zurück. Bilder "Altstadt Würzburg"
Nach einer Woche waren wir am Sonntag wieder auf dem Heimweg nach Hildesheim. Während ich mich für die Exerzitien, an denen Jutta im hiesigen Kloster Marienrode teilgenommen hat, nicht begeistern konnte, fand ich das Konzept des Klosters Hegne am Bodensee einfach vorbildlich. In einer wunderschönen Landschaft konnte man "die Seele baumeln lassen" und auch interessante Ausflüge unternehmen. Das Haus St. Elisabeth war die Oase, die der Entspannung und Erholung diente. Es wurde keinerlei Druck ausgeübt und das gewünschte Gespräch konnte man in Eigeninitiative suchen. Wir waren begeistert!
16. Ein Ausflug nach GOTHA und ERFURT
Wir haben schon mehrmals interessante Plätze in den neuen Bundesländern besucht und waren überrascht, wie positiv sich alles entwickelt hat. Ich reiste 1964 (drei Jahre nach dem Bau der Mauer) im Alter von 20 Jahren zu meinen Verwandten in Stralsund und erlebte einerseits eine unglaubliche Gastfreundlichkeit und andrerseits die Mangelwirtschaft, die sich z.B. dadurch zeigte, dass ich meine Jeans verschenkt habe. Bereits 3 Jahre nach der Wende zog mein Sohn Jochen in den Ost-Teil von Berlin.
Von dort unternahmen wir im Oktober 1993 die ersten Ausflüge zum Kloster Chorin und zum eindrucksvollen Schiffshebewerk Niederfinow. Das Kloster Chorin ist eine ehemalige Zisterzienserabtei in der Nähe des Ortes Chorin etwa sechs Kilometer nördlich von Eberswalde im Brandenburger Landkreis Barnim. Es wurde 1258 von askanischen Markgrafen gegründet und hatte weitreichende Bedeutung am nördlichen Rand des Einflussbereichs der Askanier (Grenze mit den Slawen).
Das am 21. März 1934 in Betrieb genommene Schiffshebewerk ist das älteste noch arbeitende Schiffshebewerk Deutschlands. Es liegt am östlichen Ende des Oder-Havel-Kanals in Niederfinow/Brandenburg und überwindet den Höhenunterschied von 36 Metern zwischen der Scheitelhaltung und der Oderhaltung der Bundeswasserstraße Havel-Oder-Wasserstrasse, für die das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde zuständig ist.
Im Mai 2002 fuhren wir zu einer Erkundungstour in den Ost-Teil unseres geliebten Harzes, um von Schierke aus mit der Schmalspurbahn auf den Brocken zu fahren. Dies war ein besonderes Erlebnis, denn erstmals waren wir auf dem Berg, den man früher vom Gasthaus Brockenblick bei Hildesheim sehen konnte.
Kurz darauf wagten wir uns im Oktober 2002 nach Rügen. Die größte Insel Deutschlands war bereits 1964 (bei meinem 1. Besuch in Stralsund) über den Rügendamm leicht zu erreichen. Und ich erinnerte mich in meinen Reisebericht Stralsund an den Ausflug mit meinen Großeltern nach Binz. Als ich 38 Jahre dort später dort mit Jutta unterwegs war, konnte ich nichts wiedererkennen und die damalige Leichtigkeit war hinter den Prachtbauten verschwunden. Das Preisniveau war schwindelerregend.
Die Jungfernfahrt mit dem neuen Opel Combo Tour (Diesel!) ging im Mai 2004 nach Eisenach. Auf dem Wege dorthin besuchten wir die berühmte Wartburg. Es war nicht zu übersehen: Dies war ureigentliches Luther-Land. Man konnte es auch sehr gut spüren. Es ist schon bemerkenswert, wie der protestantische Glaube die Bedrängungen durch den Kommunismus in der DDR überstehen konnte. Es waren unsere Mitbürger, die ich bereits 1964 bei meinem Besuch in Stralsund so positiv erleben konnte.
Besonders erlebnisreich war unsere zweite Reise in die Ex-DDR mit dem neuen Opel Combo Tour nach Dresden.Wir wollten meinen 60. Geburtstag (am 13. November 2004) an der Elbe feiern. Aber erst hatten auf der Autobahn kurz vor Dresden ein Autopanne. Gottseidank war dies in der Nähe einer Haltebucht und mit vereinten Kräften konnten Jutta und ich das Problem lösen. In Dresden parkten wir unseren Wagen vor dem Hotel und nutzen nur noch die Strassenbahn für unsere geplanten Besichtigungen und die Schiffstour auf der Elbe.
Im Mai 2005 freuten wir uns auf den Besuch in Weimar .Wir fuhren wieder mit dem Wagen zu unserem Ausflugsziel in die neuen Bundesländer. Die Wanderung durch kleine Städtchen Weimar war ein besonderes Erlebnis. Wir konnten uns das Leben von Johann Wolfgang von Goethe bildhaft vorstellen. 2017 waren wir zur Kur in Marienbad. Dort begegneten wir dem bekannten, deutschen Dichter, Wolfgang von Goethe, als Denkmal (sitzend auf einem Stuhl) erneut.
Richtiggehend sportlich war im Juni 2012 die Tour nach Meisdorf. Wir übernachteten im wunderschönen Schlosshotel mit einem beeindruckenden Tiergehege. Die Wanderung zu Burg Falkenstein war im ersten Teil durch das Selketal wenig anstrengend. Dafür hatte es der Aufstieg zur Burg in sich. Als wir oben angekommen waren, freuten wir uns über unsere sportliche Leistung. Auf der Rückreise besuchten wir noch das EUROPA-Rosarium bei Sangerhausen.
|
Jutta vor dem Herzoglichen Museum |
|
|
Eine historisch interessante Reise war am Samstag, den 13. August 2016, der Ausflug nach Gotha wert, um die Thüringer Landesaustellung "Die Ernestiner - eine Dynastie prägt Europa" im Herzoglichen Museum, das unterhalb vom Schloss Friedenstein liegt, zu besichtigen (die Ausstellung fand vom 24. April bis zum 28. August 2016 statt).
Die Verbindung der Ernestiner zu Gotha und Coburg zu den europäischen Herrscherhäusern ist immer noch beeindruckend. Auch im Schloss Friedenstein entdeckten wir interessante Ausstellungen Zur Vertiefung unseres Wissens kauften wir im Museum das Buch "Die Welt der Ernestiner" und "Die Königshäuser Europas - von Gotha geadelt". Ich habe über interessante Werk geschrieben:
Ein sehr spannendes Buch mit zahlreichen Dokumenten, die dem besseren Verständis der Verbindungen der Ernestiner mit den europäischen Königshäuser dienen. Eine sinnvolle Einführung war dabei die Ernestiner-Austellung im Herzoglichen Museum des Schlosses Friedenstein zu Gotha.
Bereits am Freitag, den 12. August 2016, trafen wir nach einer 3-stündigen Fahrt in Erfurt ein und übernachteten im Victor's Residenz-Hotel. Das Hotel lag in der Nähe der Altstadt und war mit dem Auto relativ leicht zu erreichen. Eine größere Parkgarage stand zur Verfügung. Die Straßenbahnen ins Stadtzentrum standen kostenlos zur Verfügung. Ein größerer Supermarkt war. in der Nähe.
|
Zum Breiten Herd |
|
|
Nachdem wir am Samstag die Ausstellung in Gotha besucht hatten, widmeten wir uns am Sonntag, den 14. August 2016, der interessanten Erfurter Altstadt. Wir nutzten dabei die kostenlose Strassenbahn. Viele Prachtbauten überdauerten den Krieg und die DDR. Nach der Wende 1989 waren viele dieser Gebäude verfallen. In der Zwischenzeit wurden alle Renaissance-Bauten renoviert und man fühlt sich an lauen Sommerabenden fast wie in der Toskana. Ein schöner Spaziergang erschließt einem diese Eindrücke. Bemerkenswert ist auch der Domplatz mit dem Dom und der protestantischen Kirche.
|
HYUNDAI Matrix |
|
|
Am folgenden Tag reisten wir mit diesen bedeutenden Eindrücke wieder zurück nach Hildesheim. Allerdings zeigte sich beim Starten in der Parkgarage wieder die seltene Eigenschaft unseres HYUNDAI Matrix: Er wollte nicht starten! Erst nach zwei Versuchen und dem besonderen Geschick meiner hervorragenden Beifahrerin, Jutta, begann der Motor einwandfrei zu laufen. In der Zwischenzeit haben wir uns einen MITSUBISHI Space Star zugelegt, den nur noch die Hälfte Benzin verbracht und keine Startprobleme hat.
17. Auf den Spuren berühmter Kurgäste in MARIENBAD (Tschechien)
Nachdem wir im Jahre 2010 in Swinemünde (Polen) mit unserer Kur einen großen Reinfall erlebt hatten, waren wir auf die Kur in Marienbad, die 7 Jahre später stattfand, sehr gespannt. Kurz vor Reise hatten wir uns einen Mitsubishi Space Star gekauft und waren auf den Verbrauchswert auf dieser längeren Strecke von Hildesheim nach Marienbad gespannt. Der minimalste Benzinverbrauch lag bei 3,8 l/100 km, der Durchschnittswert bei 4,4 l/100 km. Es gibt in diesem Wagen eine konstante Verbrauchsanzeige und eine Anzeige, wann in den nächsthöheren Gang geschaltet werden soll.
|
Unser Modell mit derselben Farbe |
|
|
Seit über 2 Jahren nutzen wir für unsere Fahrten ein Navigationssystem TOM TOM, das uns bisher nicht im Stich gelassen hat (allerdings gibt es manchmal Aussetzer, wenn die GPS-Verbindung unterbrochen ist). So gelangten wir am Samstag, den 17. Juni 2017 in sechs Stunden wohlbehalten nach Marienbad - wobei die eingebaute Klimaanlage sehr nützlich war.
Etwas verwirrend war die Mautgebühr für die Autobahn in Tschechien. Wir hatten uns informiert, dass dafür Vignetten für eine Dauer von 10 Tagen zum Preis von 12,60 € an der Grenze gekauft werden können. Wir fanden aber keine Verkaufsstelle und fuhren ohne Vignette weiter nach Marienbad. Unterwegs stellten wir fest, dass wir nur für ein kurzes Stück (ca.6 km) die Autobahn benutzt haben. Auch die Heimfahrt absolvierten wir ohne Vignette.
|
Das FALKENSTEINER mit dem Außenpool |
|
|
Das FALKENSTEINER ist ein sehr schönes Hotel, das 1870 gebaut wurde und in dem damals zahlreiche Berühmtheiten übernachtet haben. Im Jahre 2004 wurde das Hotel österreichischen FALKENSTEINER-GRUPPE übernommen und vollständig renoviert. (Lageplan: "Falkensteiner") Das Flair der vergangenen Jahrhunderte ist in diesem ehrwürdigen Hotel immer noch zu spüren und macht sich in der etwas komplizierten Fahrstuhlnutzung bemerkbar, da auf dem Weg von unserem Zimmer 106 die Fahrstühle gewechselt werden müssen, um in den Wellnessbereich und in das Restaurant im Untergeschoss zu gelangen. (Bilder "FALKENSTEINER")
Die Behandlungen begannen am Sonntag mit einer Besprechung beim Kurarzt, der den Behandlungsplan für den einwöchigen Aufenthalt (bis zum Freitag, den 23. Juni 2017) festlegte. Insgesamt bekamen Jutta und ich 12 Anwendungen, die sich teilweise unterschieden und auch zu unterschiedlichen Zeiten stattfanden. Wir waren so den ganzen Tag im Bademantel und mit Badelatschen unterwegs und trafen uns in den Pausen am Swimmingpool. Für diese Behandlungen zahlten wir 430,- € vor Antritt der Reise. Unsere Krankenkasse TKK hat uns nach der Reise gegen Vorlage der Hotelabrechnungen ca. 30 Prozent zurückerstattet.
|
Beginn der Stadtrundfahrt vor dem FALKENSTEINER |
|
|
Aufgrund unseres umfangreichen Behandlungsplanes hatten wir relativ wenig Zeit für Aktivitäten außerhalb des FALKENSTEINER. Eine Ausnahme war die Stadtbesichtigung mit der Pferdekutsche (am Montag, den 19. Juni 2017), die sich durch den historischen Teil von Marienbad erstreckte und 50 € kostete (Dauer 45 min). (Reisetipp "Pferdekutsche") So konnten wir sehr schön nachempfingen, wo in den vergangenen Jahrhunderten die Beürhmtheiten (Goethe, Chopin, Johann Strauss, Kaiser Franz-Josef, Edward VII und Mark Twain) gekurt und einen aufwendigen Lebensstil gepflegt haben. (Bilder "Stadtrundfahrt")
|
Goethe-Denkmal vor dem Goethehaus |
|
|
Eine weitere Gelegenheit ergab sich am Mittwochvormittag, den 21. Juni 2017, als ich auf der Suche nach einem Buchladen den historischen Teil von Marienbad (den ich bereits während der Kutschfahrt kennengelernt hatte) erwanderte und dabei zahlreiche Fotomotive entdeckte. (Reisetipp "Wanderung in Marienbad")
Jutta wollte in dieser Zeit die Rudolfquelle suchen, die im südlichen Teil des großen Parks lag. (Lageplan "Rudolfquelle") Dies ist ihr hervorragend gelungen und sie kam mit interessanten Aufnahmen zurück. Bilder "Marienbad"
|
Die Rudolfquelle |
|
|
Am Samstag, den 24. Juni 2017, war unsere herrliche Wellness-Woche zu Ende und wir haben uns sehr gut erholt.
Obwohl wir uns beide im Rentenalter befinden, fühlen wir uns noch relativ fit. Deshalb werden wir gerne wieder nach Marienbad kommen, um unsere Kondition in entspannter und angenehmer Atmosphäre zu verbessern.
18. MÜNSTER - zwischen Aasee und Dom
|
|
Wir besuchten über die Jahre zahlreiche interessante Städte, wie Amsterdam (mit dem Zug), Colmar im Elsass, Erfurt (mit einem Abstecher nach Gotha), Hamburg (dort waren wir schon mehrmals, um eindrucksvolle Musicals zu besuchen) und Konstanz (mit sehr erholsamen Übernachtungen im Kloster Hegne). Das berühmte Marienbad war ein Abstecher in die Tschechei wert. Potsdam lag als Zwischenstation auf dem Weg nach Swinemünde in Polen. Nach Weimar kamen wir 2005. Und schließlich reisten wir mit dem Flugzeug für ein ausgedehntes Wochenende nach Wien und waren beeindruckt.
Diese Städtereisen (ergänzt durch Fernreisen nach Süd- und Nordamerika, Asien und Neuseeland) und längere Autoreisen zum Nordkap und über den AUTOPUT nach Griechenland habe ich in meinen beiden Büchern zusammengefasst:
("Interessante Städte rund um die Welt"
Münster hatten wir ausgewählt, da es in der Nähe liegt (ca. 240 km entfernt) und über die Autobahn A2 relativ leicht zu erreichen ist. Wir wollten auch die Stadt kennenlernen, in der 1648 der Westfälische Friede verhandelt wurde, der zum Ende des 30-jährigen Krieges in Deutschland führte und zugleich den Achtzigjährigen Unabhängigkeitskrieg der Niederlande von den Spaniern beendete.
Wir wollten aber auch die Schauplätze des Münsteraner Tatorts und des Privatdetektivs Wilsberg kennenlernen. Wir fanden zwar die Buchhandlung, die Wilsberg nebenher betreibt. Aber unser Stadtführer Ralf teilte uns während der Stadtführung am Samstag, den 9. September 2017 mit, dass die meisten Aufnahmen im TV-Studio in Köln stattfinden würden.
|
Buchladen in der TV-Serie WILSBERG |
|
|
Wir wollten das 2. Wochenende (9. bis 11. September 2017) in Münster verbringen. Für die Übenachtung hatten wir das Hotel zur Prinzenbrücke in Münster-Hiltrup ausgewählt. Dies lag sehr schön direkt am Dortmund-Ems-Kanal. Dievorbeifahrenden Schiffe konnten wir von unserem Zimmerfenster im 2. OG eindrucksvoll beobachten und fotographieren.
|
Schiff auf dem Dortmund-Ems-Kanal |
|
|
Bis zum Zentrum in Münster (Schlossplatz) betrug die Entfernung 10 km. Unser Zimmer und das Bad waren sehr sauber. Der Parkplatz war zu klein und erforderte einiges Manövrieren. Nachdem wir gegen 14 Uhr im Hotel zur Prinzenbrücke eingecheckt hatten, führen wir von Hiltrup nach Münster in die Nähe des Schlosses. Von dort wanderten wir über den Domplatz, wo gerade der wöchentliche Markt stattfand, zur Tourist-Information im Rathaus (dort befindet sich auch der Friedenssaal, in dem der Westfälische Friede 1648 abgeschlossen wurde).
|
Rathaus vom Domplatz |
|
|
Wir wollten an einer Stadtführung im Sonntag, den 10. September 2017, teilnehmen. Leider war das nicht möglich, da an diesem Tag der jährliche Marathon-Lauf um den Aasee stattfand und deshalb nahezu alle Strassen im Zentrum und am Aasee abgesperrt waren. Man empfahl uns die Stadtführung, die am Samstag, den 9. September 2017, in der Nähe des Rathauses um 16 Uhr startete und über eine Stunde dauerte. Der Rundgang endete an der St. Lamberti-Kirche mit den Stahlkäfigen, in der die toten Wiedertäufer ausgestellt wurden. Bilder "Stadtführung"
|
Stahlkäfige für tote Wiedertäufer |
|
|
Am Sonntag, den 10. September 2017, war bereits gegen 10 Uhr die Anfahrt zum Aasee, wo wir spazierengehen wollten, wegen des 16. Volksbank-MÜNSTER-Marathonlaufes ein schwieriges Unterfangen. Wir parkten bei McDonald's und gingen zu Fuß zum Aasee. Unterwegs begegneten uns die ersten Marathonläufer.
|
Marathonläufer in Münster |
|
|
Vor mehr als 40 Jahren nahm ich ebenfalls an mehreren Marathonläufen teil und erzielte - für mein Empfinden - ganz gute Ergebisse (Bestzeit 1984: 3h 18 min 13 sec). Ich empfand aber auch, dass ich mich überforderte, was sich bei meiner beruflichen Tätigkeit als Unternehmensberater und Erfinder negativ auswirkte. Was ich damit sagen will:
Nicht das LAUFEN hat mir aus den Schwiergkeiten herausgeholfen, sondern ab 1996 meine spätere Frau, Jutta Hartmann-Metzger, mit der ich mehrere Bücher über unsere gemeinsamen Reisen geschrieben habe.
|
Auf dem Tafelberg in Kapstadt (2015) |
|
|
Der Aasee ist ein künstlich angelegter Stausee und liegt mitten in Münster. Er eignet sich aufgrund seiner Ausdehnung sehr schön zu einer Rundwanderung. Der in südwestlicher Richtung stadtauswärts gelegene See hat eine Fläche von 40,2 Hektar und eine Länge von etwa 2,3 km. Er ist bis zu zwei Meter tief. Der See wird von zahlreichen Grünflächen umgeben und ist damit der größte Naherholungsraum im Stadtgebiet von Münster.
|
Baumstamm am Aasee |
|
|
Der See staut das Wasser der Münsterschen Aa, dient also dem Hochwasserschutz und sorgt für Frischluftzufuhr, weil die vorwiegend aus Südwesten einfließenden Luftmassen abgekühlt werden. Somit hat er eine bedeutende ökologische und städtebauliche Funktion für die Stadt. Dies gilt auch für die zunehmend naturnah gestaltete Umgebung des Sees, die zahlreichen Arten Brut- und Lebensraumgebiet bietet und ein beliebtes Naherholungsgebiet der Münsteraner ist. Der Wasserpegel des Sees schwankt um bis zu einen Meter.
|
e-Boot auf dem Aasee |
|
|
Nach dem Rundgang um den Aasee (wir gingen über die Tormin-Brücke auf die andere Seite) wollten wir noch die Messe im Dom. (ab 11 Uhr 45) besuchen. Dies war wegen der zahlreichen Absperrungen nahezu unmöglich. Über Schleichwege kamen wir dann doch noch rechtzeitig in den Dom. Die Messe selbst war eine Erbauung und gab uns Trost und Freude. Leider waren nur wenig Besucher anwesend.
|
St. Paulus-Dom |
|
|
Mit dem Gefühl wunderschöner Eindrücke im Herzen und mit der Überzeugung, wieder einmal die richtige Wahl für das Hotel und die Unternehmungen (Stadtbesichtigung, Wanderung um den Aasee und den Messe-Besuch im Dom) getroffen zu haben, fuhren wir am Montagvormittag, den 11. September 2017, wieder nach Hause nach Hildesheim.
19. THALE und der Hexentanzplatz
|
|
Lustige Hexe
Mehrmals wollten wir dieses Jahr einen Tagesausflug nach Thale zu den Hexen unternehmen. Leider war das Wetter nicht entsprechend. Erst am Samstag, den 7. April 2018, herrschten ideale Bedingungen, denn die Temperatur lag über 20 grd. C und der Himmel war ganztägig strahlend. blau.
Allerdings erfuhren wir am Abend im Fernsehen von dem schlimmen Ereignis in Münster, bei dem durch einen amokfahrenden Lebensmüden zwei Menschen beim "Kiepenkerl" getötet und zahlreiche Menschen verletzt wurden. Wir waren in der Zeit vom 9. bis 11. September 2017 in Münster und haben uns im Rahmen einer Stadtbesichtigung an derselben Stelle aufgehalten.
Wir haben es uns bei unseren zahlreichen Fern- und Autoreisen abgewöhnt, uns Sorgen über mögliche Terroranschläge zu machen. Deshalb freuten wir uns auch, dass wir ohne Schwierigkeiten nach 1,5 Stunden das 125 km entfernte Thale erreichten und auch sehr schnell einen großen Parkplatz bei den Seilbahnen fanden. Einen Großteil des Weges über die B 6 kannten wir bereits von unserer Fahrt zum Parkhotel Schloss Meisdorf und zur Burg Falkenstein vor 6 Jahren.
|
Kletterwald Thale |
|
|
Es war schon beeindruckend, die zahlreichen "Spaßmaschinen" im Funpark, dem Minigolf-Platz (der aus der Gondel sehr gut beobachtet werden konnte) und dem Kletterwald für die begeisterten Jugendlichen zu sehen. In jüngeren Jahren hätten wir uns sicherlich auch gerne im Kletterwald verirrt.
Nun wollten wir zuerst einmal den berühmten Hexentanzplatz auf dem Bergplateau in 454 m Höhe besichtigen. Deshalb benutzten wir die geschlossene Kabinenbahn (Berg- und Talfahrt 7,- Euro p.P. - 750 m lang) um dorthin zu gelangen.
Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit mit dem Auto bis zu einem Parkplatz in der Nähe des Hexentanzplatzes zu fahren.
|
Gondelbahn zu Hexentanzplatz |
|
|
Der Hexentanzplatz soll angeblich ein altsächsischer Kultort sein, an dem in der Nacht zum 1. Mai (Walpugisnacht) zur Verehrung der sogenannten Hagedisen (Wald- und Berggöttinnen) Feste abgehalten wurden. Der Ort wurde erst nach dem Verbot des Kultes durch die zugewanderten christlichen Franken zum Hexentanzplatz. Der Überlieferung nach wurde der Platz, zur Kontrolle des Verbots, von fränkischen Soldaten bewacht, die von als Hexen verkleideten und auf Besen anreitenden Sachsen verjagt wurden. Ein weiterer alter Kultplatz der Sachsen befindet sich auf dem Brocken.
|
Berghotel Hexentanzplatz |
|
|
Seit Langem sollen sich auf dem Hexentanzplatz in der Walpurgisnacht interessante Dinge abspielen. Hexen treffen sich hier zu einem Ausflug zum Brocken (Höhe: 1.142 m), den wir sehr gut sehen konnten. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es am Hexentanzplatz das gleichnamige Berghotel.
|
Das mystische Bodetal |
|
|
Bei guter Wetterlage (und das traf für unseren Ausflug hervorragend zu) erlebt man auf dem Bergplateau wunderbare Ausblicke in das oft mystisch wirkende Bodetal. Besonders aufregend ist in den hellgrünen Kabinenbahnen der Blick nach unten. Man kann durch den Glasboden in die Tiefe des Bodetals sehen.
|
Ausblick auf Thale |
|
|
Nach einer kletterreichen Wanderung um den Hexentanzplatz genossen wir bei einer Tasse Kaffee (2,90 Euro) im Freien noch einmal den herrliche Aussicht nach Thale. Dann spazierten wir in Richtung Bergtheater, kamen am Harzeum vorbei (wo wir am Eingang ein interessantes Schild "Lebensgefährtin" fotographierten):
|
keine Abgabemöglichkeit |
|
|
Die Walpurgishalle, die in der Nähe zu finden war, fand unser Interesse und wir besichtigten sie. Im Museum in der Walpurgishalle, welche auf Anregung des Malers Hermann Hendrich erbaut wurde, werden die Sagenwelt des Harzes und Szenen aus Goethes Faust lebendig. Darin ist auch ein Opferstein ausgestellt, der an alte Fruchtbarkeitsriten erinnert.Wir fanden das Ganze nicht besonders beeindruckend - zumal die großen Gemälde wegen der Lichtverhältnisse nicht sehr gut zu erkennen waren.
|
Die Rosstrappe |
|
|
Die Rosstrappe ist ein 403 Meter hoher Granitfels oberhalb des linken Bodeufers, der als eine der großartigsten Felspartien nördlich der Alpen gilt. Wir konnten die Rosstrappe sehr gut von der Gondelbahn aus sehen. Auf dem Felsen befindet sich eine Vertiefung, die einem riesigen Hufabdruck ähnelt. Wohl auch deshalb ranken sich seit Jahrhunderten zahlreiche Sagen und Mythen um das Granitmassiv. Die bekannteste Sage erzählt von der Entstehung des legendären Hufabdrucks, die dem Felsen seinen Namen gab. Zur Rosstrappe gelangt von Thale aus mit dem Sessellift.
Auf dem Rückweg zum Parkplatz wunderten wir uns über die verfallenen Industriegebäude und den großen Parkplatz. Zu DDR-Zeiten war hier das Werk VEB Eisen- und Hüttenwerke Thale. Zum 300jährigen Jubiläum 1986 wurde am Standort des Werks das Hüttenmuseum Thale gegründet.
|
Hüttenmuseum Thale |
|
|
Der jahrelange Investitionsstau führte nach der Wende beinahe zum Aus für das traditionsreiche Unternehmen und es gingen über 8.000(!) Arbeitsplätze verloren. Es wurde schließlich 1993 durch den Verkauf an den früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht und den Kaufmann Hans Henry Lamotte privatisiert.
Zu einer nachhaltigen Weiterentwicklung kam es aber in dieser Zeit nicht. Erst mit der Übernahme durch die Schunk Group aus Gießen (1997) wurde wieder in die unterschiedlichen Unternehmens-bereiche, vor allem die Emailleverarbeitung investiert. Am 1. Oktober 2007 wurde die EHW Thale EMAIL GmbH durch drei Privatinvestoren übernommen. Unter der Bezeichnung THALETEC produziert das Unternehmen heute mit rund 200 Mitarbeitern technisch emaillierte Apparate und Produkte für die chemische und pharmazeutische Industrie.
Obwohl die Wende nun schon fast 30 Jahre zurückliegt, sind die strukturellen Probleme in Thale noch sehr gut zu erkennen. Aus dieser Sicht ist aber auch verständlich, warum hier soviel für die Touristen (insbesondere für die Jugendlichen) investiert wird. Denn nur so kann ein Teil der verlorengegangenen Wirtschaftskraft zurückgewonnen werden.
20. Begegnung mit DINOSAURIERN in Münchehagen
|
|
Rekonstruktion eines Dinosauriers
Schon seit längerer Zeit wollten wir die Dinosaurier in Münchehagen besuchen, wobei sich diese Sehenswürdigkeit ganz in der Nähe zum Steinhuder Meer befindet, das immerwieder das Ziel unserer Tagesausflüge ist. Bei dem Besuch des Klosters in Loccum im April 1014 waren wir gewissermaßen im Nachbarort - aber für den Besuch des offenen Ausstellungsgeländes war es doch noch etwas zu kühl.
Am Pfingstmontag diesen Jahres entschieden wir uns bei herrlichem Sonnenschein für den Besuch des Dino-Parkes in Münchehagen. Von Hildesheim aus benötigten für die Entfernung von 90 km 1,25 h und benutzten die A7/A2. Das Nadelöhr befand sich in Wunsdorf an der B441. Da wir relativ früh unterwegs waren, fanden wir in der Nähe des Einganges einen schattigen Parkplatz unter einem Baum. An der Kasse (Eintritt 12,50 Euro p.P.) erhielten wir den ausgezeichneten Übersichtplan mit interessanten Informationen über die Dinosaurier.
|
Lageplan |
|
|
Wir begaben uns auf den gut gekennzeichneten Rundweg und erlebten eine sehr interessante Welt, die schon lange verschwunden ist. Alles begann mit dem Steinbruch, wo sich über 300 versteinerte Dinosaurier-Spuren fanden. Heute steht dieses Naturdenkmal "Saurierfährten" unter besonderem Schutz. In der gegenüberliegenden Schutzhalle (7) befinden sich ebenfalls besondere Dinosaurierfährten und Skelette von Dinosauriern.
|
Skelett eines Dinosauriers |
|
|
Auf dem Rundweg, der eine Länge von 2,5 km hat, begegneten uns sehr immer exotischere Wesen aus einer längst vergangenen Zeit. Bemerkenswert war auch die Größe der Dinosaurier. Nach dem Besuch der Schutzhalle kamen wir in ein Gelände mit riesigen Dinosaueriern - wie wir sie aus den spannenden Abenteuerfilmen her kennen. Insgesamt finden sich auf dem gesamten Gelände 230 lebensechte Rekonstruktionen, die uns authentische Bilder lieferten. Als begeisterter Fotograf konnte ich mich an den abenteuerlichen Motiven begeistern und gestaltete auch ein kleines Video.
|
Ein gefährliches Dinosaurier? |
|
|
Auf diese beeindruckenden Erlebnisse hatten wir uns bereits mit dem Besuch des Naturhistorisches Museum in Braunschweig im August 2017 vorbereitet. Es ist schon bemerkenswert, welche vielfältigen Möglichkeiten für unsere Weiterbildung sich gewissermaßen vor unserer Haustüre in Niedersachsen befinden. Dabei möchte ich auch das SEA LIFE Hannover nicht vergessen. Und immerwieder fällt mir die besondere Berücksichtung der Bedürfnisse unserer Kinder (z.B. Picknick- und Spieplätze im Dino-Park) auf.
21. Im Herbstmonat Oktober am Wörthersee
Dieser Urlaub benötigte einige Vorbereitungen. Da wir die Strecke von ca. 950 Kilometer nicht an einem Tag fahren wollten, bestellten wir bereits im Dezember 2018 ein Zimmer im art & business hotel in Nürnberg. Mitte August 2019 besuchte ich die ADAC-Geschäftsstelle in Laatzen bei Hannover. Ich kaufte eine 10-Tagesvignette (9,20 €) für die Autobahnfahrten in Österreich. und das Ticket für die zweimalige Benutzung der Tauernautobahn (24,- €). Die Durchfahrt sollte mit dem vorhandenen Auto-Kennzeichen erfolgen, das digital gespeichert war.
Nach der Information des ADAC könnte die linke, äußere Spur an der Mautstelle zur problemlosen Durchfahrt genutzt werden. Diese konnte ich auf der Hinreise am 28. September 2019 vor Ort nicht finden und fuhr deshalb beim Kassenhäuschen durch. Der Kassiererin nannte ich meine digitale Maut. Sie fand mich offensichtlich auf ihrem Kontrollbildschirn und ich konnte prblemlos weiterfahren. Dasselbe Verfahren wendete ich auf der Rückfahrt am 6. Oktober 2016 an.
Unsere Reise zum Wörthersee begann am Freitag, den 27. September 2019, und entwickelte sich bis nach Nürnberg zu einer regelrechten Regenfahrt, die ich mit einer angepaßten Geschwindigkeit zwischen 80 bis 100 km/h auf der Autobahn zurücklegte. Trotz Smart Phone und Tom-Tom (zur Navigation) war das Hotel nicht einfach zu finden. Auch die kurzzeitigen Parkmöglichkeiten vor dem Hotel waren beschränkt. Man empfahl uns die Feuerwehreinfahrt zu benutzen. Wir mußten im Parkhaus beim Hauptbahnhof in der Nähe parken. Dafür tauschten wir an der Rezeption unser Parkticket gegen ein Ticket, das uns am folgenden Morgen die Ausfahrt ohne Bezahlung ermöglichte.
Nachdem wir unseren Wagen in der Parkgarage abgestellt hatten, gingen wir gegen 17 Uhr in die Altstadt, die dem Hauptbahnhof gegenüberliegt. Dabei kamen wir am imposanten Königstorturm vorbei. Ganz in der Nähe entdeckten wir das Indische Restaurant SANGAM. Da dieses aber erst um 18 Uhr öffnete, sahen wir uns noch ein wenig in der Altstadt um. Wir fanden aber kein anderes Restaurant, das uns hätte überzeugen können. Am 30. April 1996 besuchten Jutta, die ich erst zwei Monate kannte, und ich das vorzügliche indische Restaurant in Hildesheim, das heute nicht mehr existiert. Erstmalig lernte ich das besonders scharfe indische Essen kennen.
Dazu bekam ich aber auch das neutralisierende "Geheimrezept" geliefert: Naturjoghurt, 21 Jahre später besuchten wir auf einer Rundreise Rajasthan. Auch dort lernte ich wieder sehr scharfe indische Gerichte kennen, für die ich aber vorbereitet war. Das indische Restaurant SANGAN führte uns über die ausgezeichneten, scharfen Speisen und das reizvolle Ambiente gedanklich wieder zurück zu unseren Abenteuern in Rajasthan und dem Taj Mahal bei Agra.
Für die "Regenfahrt" von Hildesheim nach Nürnberg (430 km) benötigten wir ca. 6 Stunden. Am folgenden Tag waren wir gegen 8 Uhr auf der Autobahn. Vorher tankten wir in der Nähe des Bahnhofs für 1,369 €/l Super-Benzin. Das Wetter besserte sich hinter den Tauern. Nach 6 h Fahrtzeit und 500 km Fahrtstrecke kamen wir in unserem Zielort Pörtschach am Wörthersee an. GOOGLE hat eine interessante Zusammenstellung inserer Reiseroute zusammengestellt. Unsere Pension Haus Luca konnten wir relativ schnell finden. Von der Ausstattung waren wir etwas enttäuscht. Dafür fanden wir die Sonnenuntergänge, die wir vom Balkon aus beobachten konnten, sehr eindrucksvoll und versöhnten uns mit den Mängeln unseres Ferienquartiers.
|
Der Abendhimmel über der Pension Haus Luca |
|
|
Am Ortseingang (aus Richtung Villach) fanden wir die Tankstelle, wo wir für 1, 194 €/l (also 13 % günstiger als in Deutschland) Super-Benzin tanken konnten. Am darauffolgenden Samstag lernte ich, dass das Wochenmagazin "Der SPIEGEL" 20 Cent günstiger verkauft wurde. Interessant ist auch ein Hinweis auf den Benzinverbrauch (Mitsubishi Space Star), der im Durchschnitt 4,3 l auf 100 km betrug (insgesamt haben wir auf dieser Urlaubsreise 2032 km zurückgelegt).
|
Hinweis zum Gustav Mahler Komponierhäuschen |
|
|
Mit dem Wetter hatten wir am Wörthersee großes Glück. Bereits am ersten Ferientag, dem Sonntag, herrschte herrlicher Sonnenschein mit Temperaturen über 20 grd. C. Wir entschieden uns für die Wanderung zum Gustav-Mahler-Komponierhäuschen, das am südlichen Wörthersee-Ufer oberhalb von Maiernigg liegt.
Zu meiner eigenen Überraschung muß ich gestehen, dass Gustav Mahler nur über seine Witwe Alma Mahler-Werfel bisher eine bestimmte Bedeutung für mich hatte und für deren "abwechslungsreiches" Leben ich mich interessierte.
Genaugenommen begann ich mich für Gustav Mahler erst mit unserer Wanderung zu seinem Komponierhäusschen zu interessieren. Die Ehe mit Alma Mahler-Werfel ist sehr gut bei Wikipedia bschrieben:
Von der Ehe hatte Mahler eher konservative Vorstellungen. Bevor er im März 1902 Alma Schindler (geboren 1879) in der Wiener Karlskirche heiratete, hatte er ihr im Dezember 1901 in einem zwanzig Seiten umfassenden Brief dargelegt, was er von ihr erwartete. Er stellte sie vor die Wahl, ihre eigenen Kompositionen einzustellen oder von der Heirat Abstand zu nehmen. Eine Ehe mit einer konkurrier-enden Kollegin konnte er sich nicht vorstellen. Alma ging darauf ein, nahm es ihm jedoch bis ins Alter hinein übel, obwohl sie sich ihres Talents als Komponistin durchaus nicht sicher war. Sie selbst war unter zahlreichen Künstlern aufgewachsen. Ihr Vater Emil Jakob Schindler und ihr Stiefvater Carl Moll waren Maler. Über ihr Elternhaus lernte sie Max Klinger, Gustav Klimt, Alexander von Zemlinsky (bei dem sie Kompositionsunterricht nahm) und andere kennen. Sie wurde in die Gespräche einbezogen, geliebt und für ihre Schönheit bewundert. Mahler und sie hatten sich im literarischen Salon Bertha Zuckerkandls kennengelernt. Alma war von Mahler als Persönlichkeit und Dirigent fasziniert. Mit seiner Musik konnte sie jedoch teilweise wenig anfangen, und in der Ehe mit dem 19 Jahre älteren Mann vermisste sie so einiges. Mahler liebte sie leidenschaftlich und innig, hatte durch sein riesiges Arbeitspensum jedoch wenig Zeit für Besuchsabende und andere Vergnügungen und war während der Ferien in einem extra für ihn gebauten Komponierhäuschen (1893–1896: Steinbach am Attersee, 1900–1907: Maiernigg am Wörthersee, 1908–1910: Toblach) vollkommen in seine Musik vertieft. Er fühlte sich als ihr „Lehrer“ in Bezug auf Weltanschauung und das Leben. Des Öfteren sprach er aus (in Briefen erhalten), dass er sich wünschte, sie hätte mehr „Reife“. Die beiden bekamen zwei Töchter, im November 1902 Maria Anna († 11. Juli 1907), im Juni 1904 Anna Justine, worüber Mahler sehr glücklich war. Der Tod der noch nicht fünfjährigen Maria Anna („Putzi“) infolge ihrer Scharlach-Diphtherie-Erkrankung ließ die Familie Maiernigg am Wörthersee fluchtartig verlassen. Putzi, die 1907 zunächst auf dem nahegelegenen Friedhof Keutschach beerdigt worden war, wurde exhumiert und am 1. Juli 1909 auf dem Wiener Friedhof Grinzing beigesetzt, denn Gustav Mahler selber wollte eines Tages bei ihr beerdigt werden.
Alma konnte es nicht verstehen, dass der so glückliche Vater 1904, während die beiden Töchter vergnügt im Garten spielten, seine Kindertotenlieder vollendete, auf Texte von Friedrich Rückert, die dieser nach dem Tod seiner Tochter Luise und seines Sohnes Ernst geschrieben hatte. Mahler starb am 18. Mai 1911 im Sanatorium Löw in Wien und wurde auf dem Grinzinger Friedhof (Gruppe 6, Reihe 7, Nummer 1; im Nebengrab Nummer 2 liegt seit 1909 seine im Juli 1907 vierjährig verstorbene Tochter Maria Anna Mahler) in einem ehrenhalber gewidmeten Grab begraben.
Nach Mahlers Tod heiratete Alma den Architekten Walter Gropius (1915) und später (1929), nach ihrer Scheidung von Gropius, den Dichter Franz Werfel. Die Tochter Anna ging mit ihrer Mutter zunächst nach Kalifornien und lebte später als Bildhauerin in Spoleto. Sie starb 1988 während eines Besuches bei ihrer Tochter Marina in London, wo sie auch beigesetzt wurde. Alma Mahler-Werfel starb am 11. Dezember 1964 im Alter von 85 Jahren in ihrem New Yorker Appartement.
Interessant ist das Komponierhäuschen von Gustav Mahler, das besucht werden kann. Es lag oberhalb seiner Villa in Maiernigg am Wörthersee. Er marschierte täglich den anspruchsvollen Fußweg nach oben, um an seinem Klavier zu komponieren. Dabei wollte er den ganzen Tag ungestört sein. Mahler übernachtete aber nicht in dem Häuschen, sondern begab sich abends wieder in seine Villa am See. Zahlreiche Fotois erinnern an seine bekannte Witwe, Alma Mahler-Werfel. In dem Tresor bewahrte er Werke von Beethoven auf. Ein nette Dame beantwortete bereitwillig unsere Fragen über Gustav Mahler (wir waren zu diesem Zeitpunkt die einzigsten Besucher) und spielte uns sein Kindertotenlieder vor, die Jutta aufgezeichnet hat.
|
Die Halbinsel mit Maria Wörth am Wörthersee (vom Pyramidenkogel) |
|
|
Bereits vor 30 Jahren verbrachte Jutta mit ihrem damaligen Freund einen schönen Urlaub am Wörthersee. Ihr Quartier befand sich im Schlosshotel in Velden. Sie kannte sich also aus ind schlug deshalb nach der Besichtigung des Komponierhäuschens einen Ausflug nach Maria Wörth vor, das ebenfalls auf der Südseite des Wörthersees liegt.
|
Die Pfarrkirche von Maria Wörth |
|
|
Nicht zu übersehen ist in Maria Wörth die Pfarr- und ehemalige Stiftskirche Hll. Primus und Felician. Sie liegt auf dem höchsten Punkt der Halbinsel. Die vermutlich unter Bischof Waldo von Freising (regierte 884–906) errichtete, urkundlich 894 erstmals erwähnte, in ihrem heutigen Erscheinungsbild spätgotische Kirche mit romanischem Kern diente als Translatio der Reliquien der Märtyrer Primus und Felicianus. Ab Ende des 9. Jahrhunderts war sie Urpfarre und Missionszentrum des Bistums Freising in Kärnten. Die Kirche ist heute durch ihre romantische Lage am See eine der beliebtesten Firmungs- und Hochzeitskirchen Kärntens. Sehr interessant ist auch der Friedhof der Pfarrkirche.
|
Die Winter- oder Rosenkranzkirche von Maria Wörth |
|
|
Die Winter- oder Rosenkranzkirche liegt westlich von der Pfarrkirche und ist etwas tiefer gelegen. Sie ist wahrscheinlich die 1155 von Bischof Roman von Gurk geweihte Marienkirche. Den Namen „Winterkirche“ bekam sie, da die Jahrestage der Heiligen, die in ihr verehrt wurden, in den Winter fielen.
|
Fische im Freibad Pritschitz |
|
|
Am darauffolgenden Montag war wieder sehr schönes Wetter und wir entschlossen uns einen passenden Platz am Nordufer des Wörthersees zu finden. Wir fuhren bei Billa und Hofer vorbei in Richtung Klagenfurt. Am Kreisverkehr bogen wir auf die Seeuferstrasse. Wir fanden aber keinen geeigneten Rastplatz am nördlichen Seeufer. Deshalb ließen wir das Auto stehen und wanderten den schmalen Weg zwischen den Bahnschienen und den Ferienhäusern entlang in Richtung Klagenfurt. Nach ca. 700 m entdeckten wir das Freibad Pritschitz. Wir genossen die Sonne, trauten uns aber nicht ins Wasser (19 grd. C?). Wir hatten auch kein Badezeug dabei. Dafür konnten wir die Fische beobachten und die Aussicht nach Maria Wörth genießen.
|
Der Wörthersee vom Pyramidenkogel |
|
|
Das wunderschöne Herbstwetter hielt auch am Dienstag an und wir entschlossen uns, zum Pyramidenkogel (ein Aussichtsturm, der oberhalb von Maria Wörth liegt). zu fahren. Dazu benutzten wir am östlichen Wörthersee die Süduferstrasse bis Reifnitz, das kurz vor Maria Wörth liegt, und bogen auf die Zufahrtsstrasse zum Pyramidenkogel ab. Für die Strecke von ca. 30 km benötigten wir 30 min. Aus einer Höhe von ca. 920 m hat man vom Pyramidenkogel einen herrlichen Blick über den Wörthersee und die herrliche Gebirgslandschaft, wie die Karawanken. Wahlweise kann man über die Treppe oder den Fahrstuhl zur Aussichtplattform gelangen. Leider hatte ich vergessen, die Wörthersee Plus Card vorzuzeigen und zahlte so den vollen Preis von 14 Euro. Jutta war die Höhe nicht ganz geheuer. Sie wartete im Gartenrestaurant auf mich.
|
Schloss Rosegg von der Burgruine Altrosegg |
|
|
Am Mittwoch war der erste und einzige Regentag und wir entschlossen uns, trotzdem das Schloss Rosegg zu besichtigen. Wir fuhren diesmal über Velden (wo Jutta vor 30 Jahren erstmals am Wörthersee sich erholte) in westlicher Richtung und fanden relativ schnell das unscheinbare Schloss Rosegg. Leider waren wir für das Schlosscafe zu früh, denn dies öffnete erst um 12 Uhr. Für den Besuch des nahegelegenen Tierparkes waren die Wetterbedingungen auch nicht optimal. Zwei Tage später hatten wir sehr viel mehr Glück mit dem Wetter und wir besuchten mit großer Begeisterung den Tierpark. Vom Hügel mit der Burgruine Altrosegg gelangen eindrucksvolle Fotos von der Schlossanlage.
|
Zufriedene Besucher (Jutta und Klaus) in MINIMUNDUS |
|
|
Am darauffolgenden Donnerstag war der Besuch vom Minimundus bei Klagenfurt angesagt. Fast die ganze Welt ist mit über 159 naturgetreuen Modellen der schönsten Bauwerke versammelt. Zahlreiche Gebäude haben wir auf unseren Reisen bereits in Natura (Taj Mahal, Chinesische Mauer, Queen Mary als Hotel in Long Beach...) kennengelernt. Die Anreise ist über die Autobahn unkompliziert und gut ausgeschildert. Kostenloser Parkplatz ist reichlich vorhanden. Im Gelände kamen wir in Kontakt mit einem Paar aus Australien. Wir kamen ins Gespräch und baten den Australier das abgebildete Foto von uns zu machen. Am folgenden Tag wollten sie nach München weiterreisen, Es gibt drei kleinere youtube-Filme von unserem Besuch im MINIMUNDUS:
|
Skahirsche im Tierpark Rosegg |
|
|
Am Freitag gelang uns mit dem Besuch des Tierparkes Rosegg bei herrlichem Sonnenschein ein einzigartiger Höhepunkt unserer Ferientage am Wörthersee. Der Tierpark ist nur 5 Minuten von Velden am Wörthersee entfernt. Der Tierpark Rosegg stellt seit über 49 Jahren einen Allwetter-Besuchermagnet für alle Gäste rund um Wörthersee, Faaker See und Ossiacher See dar. Alljährlich kommen an die 80.000 Besucher in diesen größten Tierpark Kärntens, der auf äußerst geschichtsträchtigem Areal – mit der Burgruine Rosegg und der vom Geldfälscher Ritter von Bohr 1830 angefertigtem Tierparkmauer – an die 400 Tiere in über 35 verschiedenen Arten beherbergt (die sich teilweise frei bewegen). Die Wege im Gelände haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Der obere Bereich bei der Burgruine ist nur für geübte Wanderer mit festen Schuhen geeignet.
|
Beim Freibad Sallach am Wörthersee |
|
|
Den letzten Tag vor unserer Heimreise, am Sonntag, wollten wir noch einmal am Wörthersee genießen. Deshalb fuhren wir am in Richtung Klagenfurt die nördliche Seeuferstrasse entlang und entdeckten das Freibad Sallach.. Beim erstenmal hatten wir das Freibad Sallach übersehen und landeten beim Freibad Pritschitz. Nun war dieser Platz sehr viel besser und ruhiger. Wir genossen unseren vorletzten Tag am Wörthersee. Wir hatten zwar unsere Badesachen dabei. Aber gegenüber dem Anfang der Woche (beim Freibad Pritschitz) war es etwas kühler geworden und wir trauten uns nicht ins Wasser. Auch ohne Schwimmen im Wörthersee verbrachten wir hier eine schöne Zeit.
Auf der Hinreise haben wir in Nürnberg übernachtet. Die Rückreise über die Gesamtstrecke von ca. 950 km wollten wir ohne Unterbrechung (nur mit kurzen Rastpausen) durchfahren. In meinen jungen Jahren bin sogar noch größere Entfernungen z. B. zur Cote d'Azur (1974 bis 1976) oder über die Autoput 1986 nach Griechenland gefahren. Die Heimfahrt klappte zwar ohne Übernachtung - dafür gab es aber erstaunlich viele Staus und vor Hildesheim auf der A 7 eine Totalsperrung wegen eines abgesackten Autobahnabschnittes. Meine Ortskenntnisse halfen mir, den richtigen Weg über die Autobahn nach Salzgitter zu finden. Insgesamt waren wir über 14,5 Stunden unterwegs und trotzdem glücklich über unsere wohlbehaltene Heimkehr.
Impressum
Tag der Veröffentlichung: 15.08.2017
Alle Rechte vorbehalten